Postmoderne und Psychotherapie
Klaus Grochowiak
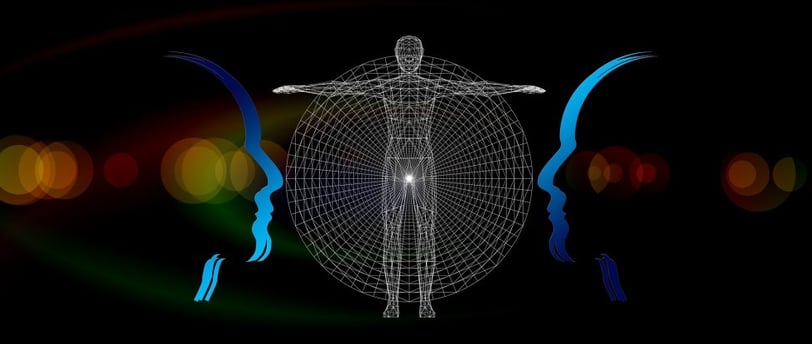
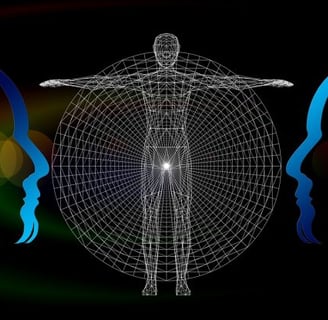
Bevor wir uns dem Thema “Die Postmoderne und die Psychotherapie” im Einzelnen zuwenden, möchte ich einige orientierende Bemerkungen darüber machen, was in diesem Zusammenhang unter dem Projekt der “Moderne” zu verstehen ist.
Die Moderne zeichnet sich im wesentlichen dadurch aus, daß sie eine soziale Ausdifferenzierung der drei großen Bereiche Selbst, Kultur und Natur erreichte. Das, was in der griechischen Antike die Einheit des Schönen, Guten und Wahren war, wird in der Moderne die Trennung von subjektivem Geschmack, allgemeiner Ethik und Moral und objektiver Wahrheit in Form der Naturwissenschaft. Den drei Begriffen Selbst, Kultur und Natur können wir auch die Begriffe Ich, Wir und Es zuordnen.
Im Bereich des Selbst geht es um die Individualität, Eigenständigkeit – unter anderem um die Eigenständigkeit der eigenen Geschmacks- und Werturteile.
Im Bereich des Wir geht es um Kultur, um Ethik, um Moral, um allgemeine Regeln des Zusammenseins, also um Gesellschaft und Vergesellschaftung.
Im Bereich Es geht es um die Frage “Wie ist die Welt unabhängig von mir und Dir objektiv gegeben”. Dies war und ist das große Projekt der modernen Naturwissenschaft.
Eine der großen Leistungen der Moderne besteht eben gerade darin, diese drei Bereiche so weit voneinander differenziert zu haben, daß es möglich wurde, daß die Wissenschaft Ergebnisse brachte, ohne daß sich der Staat oder die Kirche – was den Wahrheitsgehalt dieser Ergebnisse anging – einmischen konnte. Und die Befreiung des Individuums in der modernen Gesellschaft besteht gerade darin, daß es seinen eigenen Bereich, die Privatsphäre, das subjektive private Gewissen unabhängig von Vergesellschaftungsbedingungen haben darf und kultivieren darf.
In diesem Sinne kann das Projekt der Moderne als geglückt gelten. In allen modernen Industriegesellschaften ist diese Differenzierung gelungen. Das große Problem der Moderne scheint darin zu liegen, daß der Bereich des Es, der Bereich der objektiven Wahrheit, der Naturwissenschaft, durch seine überragenden Erfolge eine Form von Mächtigkeit, von Überlegenheit erreicht hat, in dem die Differenzierung in die Dissoziation, in die Entfremdung und in die Fraktionierung umgeschlagen ist.
Dieser Prozeß der Entzauberung der Welt (Weber), die dazu führte, daß der Mensch zu einem eindimensionalen Menschen (Marcuse) wurde, hat ein Unbehagen an der Moderne produziert, das sich im wesentlichen in drei großen Gegenbewegungen gegen die Moderne formiert hat.
Der erste große Angriff auf die Moderne läßt sich als eine Form der Retroromantik charakterisieren. Das heißt, die rückwärts gewandte romantische Verklärung früherer Formen menschlichen Daseins wird als Gegenentwurf gegen bürgerliche Entfremdung, Dissoziation und Fraktioniertheit in der Gesellschaft heraufbeschworen. Hier geht es um Schlagworte wie “Zurück zur Natur”, die Revolte gegen den Rationalismus: der Menschentyp, der hier verehrt wird, ist der Held, der Künstler, das Genie. Hier geht es um große Gefühle, um Impulse gegen Rationalität und Entfremdung bis hin zur Verherrlichung des Kindlich-Naturhaften gegenüber dem Erwachsen-Rationalen. Solche Tendenzen finden wir heute unter anderem in der New Age-Philosophie und New Age-Psychotherapie sowie in verschiedenen Formen des Ökofeminismus.
Auf der anderen Seite des Spektrums findet sich ein Versuch, den Atomismus und Reduktionismus der empirischen Wissenschaften durch einen systemtheoretischen Holismus zu überwinden. In diesem objektivistischen Holismus der Systemtheorie wird ein Begriff von Ganzheit entwickelt, der ganz im Es-Bereich bleibt, ganz im Objektiven. Man geht hier von einem hierarchischen Naturkonzept aus, in dem die verschiedenen Komplexitätsebenen wie Atome, Moleküle, Zellen, Organe, Organsysteme, Organismen, Ökosphäre bis hoch zum Universum als Ganzem als ein komplexes, sich entwickelndes, rückgekoppeltes System beschrieben werden. In diesem System allerdings befinden wir uns ganz im Objektiven, Raumhaften. Das heißt, hier gilt nur als real, was letztendlich materiell energetisch, raumzeitlich zu verorten ist. Werte, Ehre, Schönheit, Erleuchtung, Liebe, Intention, Geist, Spiritualität finden hier – wenn überhaupt – nur ihren Platz als Epiphänomen. Statt mit diesen Kategorien des subjektiven Erlebens beschäftigt man sich lieber mit der Funktionsweise des Gehirns, mit Neurotransmittern wie Serotonin und Dopamin, und glaubt, mit dem Hinweis darauf, daß jedes subjektive Erleben auch eine materielle Komponente hat, das Problem des Subjektiven, des Innerlichen, des Nichtobjektiven, erledigt zu haben. Dieser Ansatz findet sich in der Psychotherapie in verschiedenen Formen der kybernetisch orientierten systemischen Familientherapie.
Der heute in der Psychotherapie und in der Philosophie am stärksten wirksame Angriff gegen die Moderne ist das, was man allgemein die Postmoderne und den Poststrukturalismus nennt. Hier haben wir es mit Namen wie Nietzsche, Heidegger, Derrida, Bataille, Deleuze, Foucault, Lacan, Liotard usw. zu tun.
Der Schlachtruf, das Kampfwort des Poststrukturalismus und der Postmoderne lautet:
Any Thing Goes!
Es gibt nicht mehr die eine Wahrheit, es gibt viele Wahrheiten, viele Gesichtspunkte und Perspektiven, die sich nicht mehr auf irgendeine Art und Weise in ein summum bonnum, in einem höchsten Punkt vereinigen lassen.
Die zweite wesentliche Position zeigt sich daran, wie das Verhältnis von Zeichen und Bedeutung des Zeichens verstanden wird. Die Postmoderne argumentiert, daß uns der Sinn nur vermittels von materiellen Zeichen, Lauten, Gesten, Buchstaben usw. gegeben ist. Und diese Signifikanten entwickeln mitunter ein Eigenleben, daß nicht mehr vom Sinn beherrscht wird, sondern umgekehrt Sinn erzeugt. Dies ist besonders anschaulich an der Metapher zu zeigen. Hier werden Worte in neuen Kontexten und Zusammenhängen auf eine Art und Weise genutzt, die neuen Sinn produziert. Im klassischen, von Plato inspiriten Idealismus waren es die Ideen, vor jeder materiellen Inskription, die die Sprache und die Schrift mit Sinn und Bedeutung erfüllt haben. Diese Ideen waren aber selbst nicht an materielle Träger gebunden. Das “freie Spiel der Signifikanten” wird zum Gegenmodell logozentrischer Vorstellungen über die Sinnproduktion.
Im Gegensatz zur objektivistischen, empiristischen und reduktionistischen Naturwissenschaft, der es darum geht, herauszufinden, wie die Welt ist, geht es diesen Denkern im wesentlichen darum, zu verstehen, was die Welt für uns bedeutet. Eine rein naturwissenschaftliche Analyse – zum Beispiel des “Faust” von Goethe – würde bedeuten, das Buch empirisch zu untersuchen, wieviel es wiegt, wie viele Buchstaben darin enthalten sind, vielleicht wie viele Verben, welche Satzstruktur, rein statistisch besonders häufig ist usw. Einem solchen Zugang würde sich aber die Bedeutung, die Intention dieses Werkes völlig entziehen.
Eine naturwissenschaftliche Analyse eines Gesichtsausdrucks würde bedeuten: welche Muskeln sind wie angespannt, welche Stellung haben die Augen usw.; die Frage: Was bedeutet dieser Gesichtsausdruck, wie verstehe ich diesen Gesichtsausdruck, ist nur dialogisch, nicht monologisch zugänglich. Das heißt, all das, was im weitesten Sinne subjektiv ist, muß interpretiert werden und kann nicht durch eine reine Ist-Analyse dargestellt werden. Da das Subjektive aber selbst Teil des Kosmos ist, gibt es keine Möglichkeit, das Subjektive letztendlich auf irgendeine Art und Weise auf einen objektiven Tatbestand zurückzuführen.
Die Postmoderne ist sich einig in ihrem Kampf gegen den Objektivismus, gegen den “Mythos des Gegebenen”. Im Mythos des Gegebenen wird das hermeneutische Moment jedes Weltverstehens geopfert. Aus dieser grundsätzlichen Einsicht der postmodernen Denker ergeben sich drei wesentliche Aussagen, die diesen Denkern gemeinsam sind – drei wesentliche Positionen, die sie in ihren Werken auf die unterschiedlichste Art und Weise versuchen zu begründen und zu verteidigen.
1. Die Realität ist nicht einfach gegeben, sondern konstruiert (Konstruktivismus).
2. Jede Bedeutung ist kontextabhängig. Es gibt beliebig viele Kontexte. Es gibt keine Möglichkeit, den eigentlichen wahren, wirklichen Kontext zu bestimmen (Kontextualismus).
3. Multiperspektivismus: Die Welt kann und wird faktisch von vielen Menschen aus vielen Perspektiven beschrieben und sieht aus jeder Perspektive anders aus. Es gibt keine eigentliche, richtige, wahre Perspektive. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer Vermittlung der vielen Perspektiven (Perspektivismus).
Aus diesen drei Statements und der Grundaussage, daß es hier im wesentlichen um den Bereich des Interpretativen geht, ist klar, daß dieser Ansatz als ganzer für den Bereich der Psychotherapie sozusagen schon von Hause aus oder thematisch relevant ist.
Man könnte durchaus mit einer gewissen Berechtigung sagen, daß sich die moderne Psychotherapie darin einig ist, daß der Mensch ein Tier ist, das die Möglichkeit hat, an Bedeutung zu erkranken. Das heißt, für uns ist die Welt nie einfach nur gegeben, sondern alles Gegebene hat für uns einen Sinn, eine Bedeutung, die durch den Kontext und durch die Interpretation, durch unsere Perspektive allererst konstruiert wird. Psychotherapie wäre in diesem Sinne die Kunst und Wissenschaft davon, wie man Menschen helfen kann, von ungünstigen und krankmachenden Bedeutungskonstruktionen zu gesunden und befriedigenden Bedeutungskonstruktionen und Interpretationen überzugehen.
Wenn man jetzt noch die Einsicht dazu nimmt, daß ein Bedeutungserlebnis bei einem Menschen nicht nur ein rein mentales Ereignis ist, sondern daß jede “semantische Reaktion” (Alfred Korzybski) darstellt, dann wird verständlich, warum eine Veränderung der Bedeutung zur Folge hat, daß auch sogenannte psychosomatische Leiden durch die Veränderung der Interpretation und der Bedeutung tiefgreifend verändert werden können. Insofern wäre Reframing (Umdeuten) das Motto der modernen Psychotherapie.
Diese wichtigen und richtigen Einsichten des postmodernen und poststrukturalistischen Denkens haben aber an verschiedenen Stellen zu Übertreibungen geführt, die dazu führten, daß die berechtigte Kritik und die richtigen Einsichten wieder ins Gegenteil umgeschlagen sind. Diese Übertreibungen finden wir sowohl in der Philosophie und postmodernen Linguistik als auch in den Adaptionen in verschiedenen Formen der Psychotherapie.
Aus diesem Grund möchte ich mich im Folgenden damit beschäftigen, die oben genannten drei Punkte näher zu erläutern und zu begründen sowie zu zeigen, wie und wo sie übertrieben worden sind und wie und wo wir Spuren dieser Übertreibungen in der gegenwärtigen Psychotherapie finden und inwiefern wir diese Übertreibungen sinnvollerweise wieder rückgängig machen können bzw. zu zeigen, inwiefern diese Übertreibungen überhaupt nur eine Rolle in Vorworten, Nachworten und metatheoretischen Kommentaren spielen. Das heißt, sehr häufig ist es so, daß in der konkreten psychotherapeutischen Praxis die theoretischen, ideologischen Übertreibungen verschiedener Positionen praktisch kaum eine Rolle spielen. Und auch diese Differenz zwischen handwerklicher Nützlichkeit verschiedener therapeutischer Verfahren und ihrer jeweiligen philosophischen und theoretischen Einordnung und Begründung scheint mir etwas zu sein, was für das Verständnis moderner Psychotherapie wesentlich ist.
Ad 1: Realität ist nicht einfach gegeben, sondern konstruiert
Was ist damit gemeint?
Machen wir ein kleines Experiment:
Während Sie dieses Buch lesen, können Sie sich Ihre Hand ansehen und Sie werden an dieser Hand fünf Finger finden, die unterschiedlich lang sind. Die Frage, die wir uns jetzt stellen wollen, ist “Was an dieser Aussage ist ‘gegeben’ und was ist ‘konstruiert’?” Das Konzept der Zahl Fünf ist etwas, was uns mit Sicherheit nicht gegeben ist – nirgendwo in der Welt da draußen gibt es die Zahl Fünf. Des weiteren – wenn wir von dem Unterschied der Finger sprechen – können wir uns sofort fragen “Wo ist der Unterschied als Unterschied?” Was wir sehen können sind die Finger, wir können auch sehen, daß sie nicht die gleiche Länge haben, aber das Konzept des Unterschieds oder auch den Unterschied als Unterschied können wir nicht hinweisen als etwas Gegebenes, etwas, was es draußen in der Welt gibt.
Insofern ist die Aussage “Ich habe fünf unterschiedliche Finger” eine Mischung aus Wahrnehmung und Konstruktion durch den kategorialen Apparat, den ich an die Wahrnehmungen herantrage. Diese Einsicht ist uns spätestens seit Kants Kritik der reinen Vernunft geläufig.
Eine der standardmäßigen Übertreibungen im postmodernen Denken besteht jetzt darin, zu behaupten, daß es überhaupt keine Wahrnehmung gibt, sondern nur Interpretation, daß es überhaupt keine Realität gibt, die irgend etwas begründen könnte, sondern nur noch Interpretationen, denen jegliche Objektivität abgeht. Das heißt, so etwas wie Fortschritt der Wissenschaft, Fortschritt des Erkennens der Welt, ist eine reine Illusion. Und das, was die Interpretationen letztendlich leitet, sind verschiedene Formen von Machtmißbrauch, von Ideologien, die verschiedenen Formen von Logozentrismus, Phallozentrismus, Ethnozentrismus usw. Diese Position verstrickt sich allerdings durch diese Behauptung in den bekannten Selbstwiderspruch jeglicher Art von radikalem Skeptizismus. Denn, wenn die Position richtig ist, gilt die Aussage, daß alles nur Interpretation ist, natürlich für diese Theorie oder diese Konzeption selbst und insofern kann sie selbst nur einen ideologischen Charakter haben.
Abgesehen davon scheint mir diese Position mit dem realen technologischen Fortschritt real völlig unvereinbar zu sein. Sie ist vielmehr die abstrakte Negation des naturwissenschaftlichen Objektivismus, in dem es gar keine Interpretation, gar keine Bedeutung, sondern nur Tatsachenbehauptung über raumzeitlich materiell energetische Ereignisse gab.
Ad 2: Bedeutung ist kontextabhängig
Jede Bedeutung kann durch einen neuen Kontext verändert werden. Die amerikanische Form des Dekonstruktionismus besteht nun gerade darin, zu zeigen, daß jede Bedeutung dekonstruiert werden kann und damit ad absurdum geführt werden kann. Selbst Foucault, der durchaus zu den Sympathisanten des Dekonstruktionismus zu rechnen ist, bezeichnet diese Tendenz als Terrorismus. Aus der Tatsache, daß immer wieder neue Kontexte konstruiert werden können, respektive daß die Konstruktionsbedingungen einer Bedeutung dekonstruiert werden können, den Schluß zu ziehen, daß alles willkürlich und beliebig ist, führt nur zu einem radikalen Skeptizismus und Relativismus, der letztendlich diese Position selbst trifft und sie dadurch relativiert bzw. ad absurdum führt.
Daß jede Information nur in einem Kontext eine Bedeutung bekommt und in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Bedeutungen hat, ist namentlich im NLP, im sogenannten Kontext-Reframe, in den Rang einer eigenständigen therapeutischen Technik erhoben worden. Des weiteren kann die Arbeit von Milton H. Erickson und des Mental Research Institut (MRI) in weiten Teilen als eine Entwicklung des Reframing-Konzepts betrachtet werden. Und Frame, Rahmen ist hier nur ein anderes Wort für Kontext.
Aber in der Psychotherapie ist man natürlich nie auf die Idee gekommen, jeden Kontext als völlig gleichwertig zu verstehen. Einige Kontexte und die damit zusammenhängenden Interpretationen führen eben zu seelischen Störungen und Krankheit und andere eher zu Selbstbewußtsein, Gesundung und Nutzung der eigenen Ressourcen. Um dies aber als etwas Sinnvolles betrachten zu können, muß man sich auf Hierarchien, auf Wertdifferenzen usw. einlassen.
Nur wenn ich den Unterschied zwischen besser und schlechter, angenehmer und unangenehmer, gesund und krank, machen kann, habe ich Kriterien, die eine Auswahl und Entscheidung bezüglich eines Kontextes der Interpretation erlauben.
Ad 3: Multiperspektivismus
Ein wesentlicher Aspekt des Multiperspektivismus besteht gerade darin, daß die Sprache selbst nicht als ein neutrales klares Fenster betrachtet wird, durch das wir die Welt anschauen, sondern hier gilt eher die Devise des späten Wittgenstein: “Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt”. Dieser sogenannte Linguistik-Turn, die Wende hin zur Linguistik, ist eine der wesentlichen Aspekte der postmodernen Philosophie und des Poststrukturalismus. Mehr noch das Wort Poststrukturalismus ist ohne die Abgrenzung von Saussure, dem Begründer des linguistischen Strukturalismus überhaupt nicht verständlich.
Und da wir spätestens seit Freud wissen, daß Psychotherapie in weiten Teilen das ist, was man eine “Talking-Cure” nennen könnte, ist die Auseinandersetzung mit der Sprache, der Sprachphilosophie für Psychotherapeuten von fundamentaler Bedeutung. Insofern möchte ich hier auf diesen Punkt, die Auseinandersetzung mit Saussures Linguistik etwas näher eingehen.
Das Werk “Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft” von Ferdinand de Saussure ist zum ersten Mal 1916 auf französisch erschienen. Für ihn ist “Die Sprache ein System von Zeichen, die Ideen ausdrücken”. Dementsprechend konzipiert er die Semiologie als eine Wissenschaft vom Leben der Zeichen im Rahmen des sozialen Lebens. Das sprachliche Zeichen besteht nach Saussure aus zwei wesentlichen Elementen, nämlich aus Vorstellung und Lautbild. Das Zeichen ist also die Verbindung von Vorstellung und Lautbild. Das Zeichen Baum besteht also als Lautbild im wesentlichen aus Schallwellen und die Vorstellung ist mein inneres Bild, das ich bekomme, wenn ich das Wort Baum verstehe. Diese beiden Elemente des Zeichen nennt er auch Bezeichnetes und Bezeichnung oder Bezeichnendes. Der reale Baum, der im Garten steht, auf den sich dieses Wort dann bezieht, bezeichnet er als den Referenten – das, worauf das Zeichen referiert, sich bezieht.
Die nächste wesentliche Einsicht Saussure besteht darin, daß alle sprachlichen Zeichen beliebig sind, d.h. für den realen Baum müßten wir nicht notwendig die Lautgestalt Baum wählen. Dies wird unmittelbar einsichtig aus der Tatsache, daß in anderen Sprachen (z.B. im englischen oder französischen [tree, arbor]) für den gleichen Referenten andere Zeichen benutzt werden. Aber selbst innerhalb jeder einzelnen Sprache verändern sich die Zeichen für bestimmte Gegenstände im Laufe der Zeit.
Daraus schließt Saussure, daß jedes Wort seine Bedeutung nur im Kontext eines Satzes erhält. Und allgemein gesagt, ist es die Relation aller Worte einer Sprache untereinander, die die Bedeutung stabilisiert. Das bedeutungslose einzelne Element der Sprache bekommt seine Bedeutung also durch die gesamte Struktur. Diese Position führt dann zur Bezeichnung Strukturalismus.
Der Strukturalismus ist in der Linguistik die Position, die darin besteht, daß die Struktur das Wesen der Sprache und des Bedeutungsprozesses ist und nicht das einzelne Wort. Das heißt, die Vorstellung, daß ein einzelnes isoliertes Subjekt vor der Welt steht, auf ein Objekt schaut und mit Hilfe einer Zeigebewegung und eines beliebigen Namens dieses Objekt benennt, wird im Strukturalismus zwar nicht geleugnet, aber ein solcher Akt des Benennens ist nur im Rahmen einer schon vorhandenen Sprache möglich. In diesem Zusammenhang sei auch an die Untersuchung von Wittgenstein zur Unmöglichkeit der Privatsprache erinnert.
Vor Saussure wurde namentlich im Empirismus davon ausgegangen, daß Wissen durch Repräsentation zustande kommt (Repräsentationalismus). Sprache, in der Wissen ausgedrückt wird, wurde in dieser Konzeption als eine Karte aufgefaßt, die das Territorium strukturell entweder angemessen oder eben nicht angemessen, abbildet, repräsentiert.
Saussure gab die erste moderne und vernichtende Kritik dieser empiristischen Theorie des Wissen, indem er zeigen konnte, daß die Bedeutung durch intersubjektive Strukturen zustande kommt, auf die selbst nicht gezeigt werden kann, die selbst keine objektiven Ereignisse in Raum und Zeit darstellen. Bedeutung wird nicht von einem isolierten Subjekt selbstherrlich kreiert, sondern es ist für jedes Objekt immer schon kreiert – kreiert durch den Sprachhintergrund, die Kultur, die Kommunikation usw.
Diese Position Saussures führt jetzt in die Extremform der postmodernistischen und poststrukturalistischen Sprachphilosophie zur Konzeption vom Tod des Menschen, des Autors, des Subjekts. Das Subjekt wird jetzt ausschließlich zu einem Effekt der Intersubjektivität. Nicht ich spreche, sondern die Sprache spricht durch mich hindurch.
Die Tatsache, daß jedes Ich eingebettet ist in ein Wir wird zu : Es gibt kein Ich!
Für Saussure war das Zeichen die Einheit von Signifikat (Bedeutung) und Signifikant (Bedeutendes). Im extremen Postmodernismus und Poststrukturalismus wird aus der Einsicht, daß das Signifikat nie außerhalb des Spiels der Signifikanten existiert die absurde Behauptung, daß es nur noch eine gleitende Kette, ein Spiel von Signifikanten gibt. Die geschriebenen, materiellen Markierungen werden zum eigentlichen Gegenstand.
Wie oben schon betont ist diese Umkehrung des Platonismus eine völlig legitime und sicherlich mehr als notwendige Bewegung zu Verständnis des Bedeutungsprozesses. Wogegen ich mich hier abgrenze ist die Übertreibung dieser Position die in dem “nur noch” liegt. Bei Saussures Strukturalismus gab es noch beides: Repräsentation und Konstitution. Im Poststrukturalismus gibt es nur noch Signifikanten, die dem Spiel von Macht, Ideologie usw. gehorchen. Der Postmodernismus leugnet jegliche Tiefe. Dies läßt sich an de Shazers Kritik des Strukturalismus verdeutlichen.
Für ihn gibt es eine strukturelle Isomorphie zwischen den folgenden Hierarchien:
Bezeichnetes/Bezeichnung, Unbewußtes/Bewußtes und Tiefenstruktur/ Oberflächenstruktur. Mit Hilfe der Unterscheidung Tiefen-/Oberflächenstruktur, die Bandler und Grinder aus der generativen Grammatik Chomskys übernehmen, wollen sie in der Lage sein die vollständige Repräsentation des Gemeinten aus dem Übergang von Oberflächenstruktur zu Tiefenstruktur abzuleiten. Wenn sich nun zeigt, daß nicht nur in der Oberflächenstruktur etwas fehlt, was durch die Tiefnestruktur ergänzt wird, sondern wenn sich zeigt, daß in der Tiefenstruktur selbst etwas fehlt, muß man entweder zu einer Tiefenstruktur der Tiefenstruktur oder zu einem “Außerhalb” von Tiefen-/Oberflächenstruktur übergehen. Dieses Loch, dieses fehlen eines festen Bedeutungskerns ist das Skandalon des Strukturalismus und damit seine konzeptionelle Schwachstelle. Die Frage bleibt natürlich, was daraus folgt. Wenn die Bestimmung der Bedeutung eines Wortes uns immer und unvermeidlich auf ein weiteres Wort verweist, dann liegt der Gedanke nahe, daß es “real” außerhalb dieser Kette von Signifikanten nichts gibt. Dies führt dann zu Positionen wie: Letztlich können Menschen sich nicht verstehen, also kann ich den Klienten auch nicht verstehen, also macht es gar keinen Sinn dies erst zu versuchen usw. Steve de Shazer betrachtet dann seine Skalen als einen Versuch dieses Dilemma zu umgehen. Inwieweit allerdings für die Erklärung dieses Vorgehens der Klient ihn verstehen muß wird nicht thematisiert. Aus der Tatsache, daß es kein festes Bedeutungszentrum gibt wird eine viel zu weitreichende Schlußfolgerung gezogen, die das Kinde mit dem Bade ausschüttet und zu einer Verherrlichung von Flatland wird. Es gibt nichts unter der Oberfläche des Textes, keine Bedeutung, keine Werte, keine Hierarchien, keine Qualitäten usw.
Auch für diese Theorie gilt, daß sie auf sich selbst angewandt sich selbst ad absurdum führt.
Eine weitere Möglichkeit, die sich aus dieser Situation ergibt besteht darin den Multiperspektivismus, die Vision-Logic, die Polykontexturale Logik als eine integrale Eigenschaft des Kosmos selbst zu interpretieren. Dann gilt es den Chiasmus von Information und Bedeutung, von Signifikant und Signifikat als komplexe Struktur zu denken, die es nicht nötig hat entweder auf struktureller Geschlossenheit (Strukturalismus) oder auf struktureller Flachheit zu beharren und damit die Erkenntnisse aller Hermeneutik zugunsten eines Spiels der Signifikanten zu reduzieren, dass sinn- und freudlos geworden ist.


