NLP im Coaching als Lebenskunst
Klaus Grochowiak
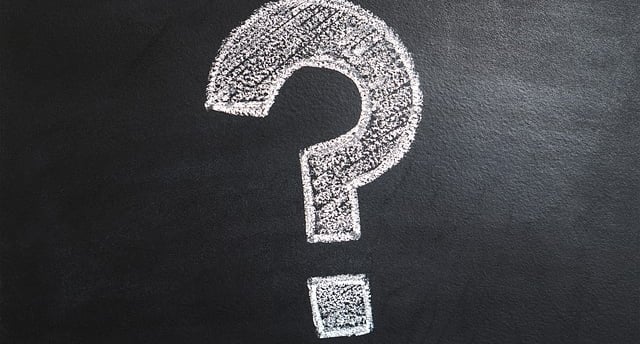
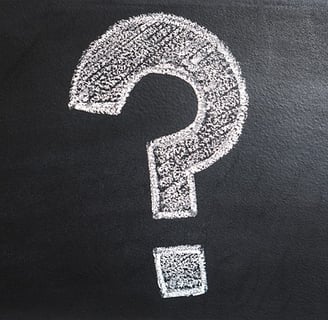
Wenn man Teilnehmern eines Practitioner-Kurses die Frage stellt, was sie zur Teilnahme motiviert hat, dann ist eine der wichtigsten Antworten: „Ich wollte mal wieder was für mich selbst tun.“ Natürlich wollen die Teilnehmer auch ihre Kommunikationsfähigkeit verbessern oder ihre therapeutische Tool-Box erweitern, aber das Hauptmotiv bleibt das Bedürfnis, etwas für die eigene Entwicklung als Lebenskunst zu tun. Dieses Bedürfnis haben die alten Griechen Selbstsorge (epiméleia heautoú) genannt. Zusammen mit der Aufforderung „Erkenne dich selbst“ (gnóthi seautón) geben sie den Horizont für die Beantwortung der Frage „Wer sind wir?“ ab. Sich selbst zu kennen war die Voraussetzung, um sich um sich selbst kümmern zu können.
Wir können auch sagen: Wer sich um sich selbst kümmern will, ist einer, für den „sich das Leben nicht mehr von selbst versteht.“ Epiméleia heautoú können wir auch als eine Form der Lebenskunst begreifen – und das Bedürfnis nach solcher wird in Zeiten, in denen sich traditionelle Lebenszusammenhänge rasant verändern, zu einem begehrten Gut. Der Verfall der Stadt, des Adels usw. sind schon bei den Griechen (5. Jahrhundert v. Chr.) der Hintergrund für die Beschäftigung des Selbst mit sich selbst.
Epiktet sah den Menschen als das einzige Wesen, das sich um sich selbst kümmern muss. Tiere brauchen das nicht: Sie sind ganz eins mit sich. Der Mensch hingegen ist nie eins mit sich. Sloterdijk bestimmt den Menschen als ein Wesen, das konstitutiv in einer Vertikalspannung lebt. Er ist nie mit sich selbst identisch. Er ist immer ein Mehr oder Weniger, relativ zu seinen Möglichkeiten und relativ zu anderen. Heute würde man im NLP sagen: Die Spannung zwischen Sein und Sollen, zwischen seinen verschiedenen Teilen, ist unaufhebbar und verlangt nach einer lebenslangen Selbstbeobachtung (Seneka). Und es ist nie zu spät und nie zu früh, damit zu beginnen, sich um sich selbst zu kümmern (Epikur).
Ein Hauptmotiv dieser Selbstsorge als Lebenskunst war der Seelenfrieden. Dieser ist für den gewöhnlichen Menschen ständig durch unbeherrschbare äußere Einflüsse gefährdet. Da wir wenig Einfluss auf diese äußeren Einflüsse haben, wird Epiktet zum ersten großen Reframer: “Es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die Bedeutung, die wir ihnen beimessen.”
Im antiken Griechenland (400 vor bis 400 n. Chr.) wurde Psychotherapie – oder genauer gesagt: psychosomatische Medizin – in Stätten betrieben, die man Asklepeion nannte. Das Asklepeion verdankt seinen Namen dem altgriechischen Gott der Heilkunst: Asklepios. Es gab ca. 300 dieser Heilstätten. Besondere Bedeutung kommt der Anlage auf der Insel Kos zu, da hier der berühmte Arzt Hippokrates praktizierte. In den Ruinen des Asklepeion in der Nähe von Pergamon finden wir heute noch Denkmäler für die beiden wichtigsten Heilpflanzen, die damals benutzt wurden: Schlafmohn und Oliven. Der Schlafmohn regt nicht nur zum Schlafen an, er erhöht auch die Suggestibilität; Olivenöl hat verschiedenste positive Wirkungen auf die Gesundheit. Es gab auch Theater, in denen die Patienten Lehrstücke vorgeführt bekamen, die ihnen ihren Anteil an ihrem Leiden verdeutlichen sollten.
Eine interessante Interventionsmethode bestand darin, die Patienten durch einen langen, dunklen und kühlen Tunnel laufen zu lassen. In diesem Tunnel gab es zwölf Oberlichter – Durchbrüche in der Decke –, an denen Therapeuten saßen, die dem Patienten heilende Suggestionen zuflüsterten, die dieser besonders leicht aufnehmen konnte, da die Luft im Tunnel mit Schlafmohnrauch angereichert war.
Epiktet stellte sich seine Schule als eine medizinische Institution vor, in der die Krankheiten der Seele geheilt wurden: eben negative Emotionen und limitierende Überzeugungen. Es gab Kurzzeittherapien für Klienten sowie langjährige Ausbildungen und Techniken, die einem bei der Sorge um sich selbst helfen sollten. Nach seiner Lehre soll der Mensch strikt unterscheiden, welche Dinge und Geschehnisse von ihm selbst beeinflusst werden können und welche nicht. Dies erinnert an das Diktum von Bandler und Grinder, wonach es im NLP unter anderem darum geht, äußere Variablen in innere umzuwandeln.
Marcus Aurelius, ein Schüler Epiktets, formulierte das Ziel all dieser Bemühungen als eine Lebensform, in der die Rückwendung auf sich selbst zum zentralen Lebensinhalt wird. Es geht um vollständige Beherrschung seiner Selbst, vollständige Unabhängigkeit von äußeren Umständen. Es geht darum, sich von allen übernommenen Einstellungen zu befreien. Niemand ist allerdings stark genug, um sich selbst zu befreien: Ein Meister oder Lehrer ist notwendig (Seneka).
Der geneigte Leser wird kaum umhinkommen, hier eine unerwartete Traditionslinie zu erkennen, die uns heutige Selbstoptimierer mit den nach Perfektion strebenden Menschen der Antike verbindet. Ihnen ging es um Perfektion in diesem Leben und nicht – wie bei den späteren Christen – um die Erlösung in einem Leben im Jenseits. Ziel war also eine Ästhetik der Existenz, die mit ihren Mitteln und Zielen ganz in der Endlichkeit dieser Existenz bleibt.
Die christliche Sorge um das Seelenheil knüpfte zwar an stoische Techniken an, aber mit einer ganz anderen Stoßrichtung. Viele der stoischen Techniken finden sich später bei den Mönchen des Benediktiner-Ordens wieder – aber eben mit dem Ziel zu untersuchen, wie es um die Reinheit der Seele angesichts des Jüngsten Gerichts steht. In der christlichen Tradition verlor die Sorge um sich selbst ihren freiwilligen Charakter: 1215 n. Chr. wurde die Beichte obligatorisch. Man musste jetzt beichten, man musste fasten usw. Auch die Wahl des Meisters war nicht mehr frei: Der örtliche Priester war dafür zuständig – und natürlich entschied der über die entsprechenden Strafen.
Bei Gregor von Nyssa finden wir die Abwendung vom Fleisch, die uns die Unsterblichkeit zurückbringen soll. Der Übergang von der griechisch-römischen Kultur des Selbst zur christlichen spiegelt sich auch – und nicht zuletzt – im Übergang von der Beschäftigung mit dem angemessenen Umgang mit den Lüsten zur Analyse des Begehrens als einem schon immer teuflischen.
Die griechisch gedachte Sorge für sich selbst wurde durch die christliche Tradition der Selbstaufopferung ersetzt (Thomas a Kempis: Imitatio Christi). Es entstand eine Faszination an der eigenen Leidensfähigkeit (Entselbstung). Zur selben Zeit entwarf Pico della Mirandola (15. Jh.) „den Menschen als das Tier ohne Eigenschaften“. Der Mensch musste sich seine Eigenschaften selbst schaffen. Als „plastes et fictor“ musste er die Verantwortung für sein Sein übernehmen. Diese autoplastische Selbstdefinition könnte gut und gern der Titel eines modernen Selbsthilfe-Buches oder für ein einwöchiges Seminar auf Hawaii sein: Werde, der du schon immer sein wolltest. Wir sehen also, dass selbst die überspanntesten kalifornischen Konzepte des „self branding“ in einer alteuropäischen Tradition stehen.
Im 16. Jahrhundert war es Michel de Montaigne, der mit seinen Essays nicht nur eine literarische Tradition begründete. Der Essay (Versuch) wurde für ihn eine experimentelle Lebensform, in der er versuchte, „mit seiner eigenen Existenz zu experimentieren und sich selbst zu erproben.“ Man kann in diesem Zusammenhang von einer essayistischen Existenz sprechen. Dies meint vor allem, den Menschen offenzuhalten für seine Möglichkeiten. Sind nicht auch wir gezwungen, mit unserer eigenen Existenz zu experimentieren? Welche Beziehungsform passt zu mir, welcher Beruf? Wo will ich leben und arbeiten? Was will ich über mich selbst glauben? Wer will und könnte ich sein? „Warum bestehst du darauf, du selbst zu sein, wenn du die Möglichkeit hättest, etwas wirklich Großartiges aus dir zu machen?“ (Bandler)
Im Gegensatz zu den vormodernen Kulturen, in denen diese Fragen durch die Tradition immer schon beantwortet waren, müssen wir sie in unserem Leben immer wieder neu beantworten. Moderne ist nur ein anderes Wort für eine Befreiung von solchen traditionellen Strukturen.
400 Jahre später wird Heidegger in „Sein und Zeit“ den Entwurf als Erschließen der Möglichkeit des Seinkönnens, nämlich die Sorge als Inbegriff des Selbst bestimmen. Und Sartre beschreibt in „Das Sein und das Nichts“ den Menschen als das Wesen, „das nicht dem Sein im Sinne des Gegebenen verpflichtet bleiben muss, sondern das Nichts als das gegenwärtig noch nicht Existierende in den Blick nehmen kann. Der Entwurf eines Andersseins kann jedes Individuum für sich selbst wagen, entscheidend ist seine Wahl.“
„Eine Wahl zu haben ist besser als keine zu haben, und Möglichkeiten zu erschließen ist besser, als aus einer gegebenen Auswahl auswählen zu müssen.“ schreiben zwei junge Amerikaner Anfang der 70er-Jahre.
Vom 15. Jahrhundert über die Essayistik Montaignes bis zur Romantik des 18. Jahrhunderts, in der die Parole lanciert wurde, dass der Mensch ein Wesen ist, das über sich hinausgehen muss, gibt es eine Linie der Anthropotechnik (Sloterdijk), die mit dem NLP eine neue Variante hervorgebracht hat.
NLP versteht sich als eine Technik der Selbstoptimierung, die in der Tradition des 18. Jahrhundert steht und sich auf die Fahnen geschrieben hat, dass alle Vertikaldifferenzen in Horizontaldifferenzen umformuliert werden können und sollen.
Jede Unterteilung der Menschen in konstitutionell höhere und niedere wird als eine gemachte, ausgedachte Differenz entlarvt. Seit den mesopotamischen Stadtstaaten gab es die Figur des Gottmenschen, des Gottkönigs. Auch in den asiatischen Kulturen gab es die Vorstellung des Avatar – ebenfalls eine Form des Gottmenschen. Die Heiligen erscheinen uns heute nur noch als solche, die sich ungewöhnlichen Trainingsroutinen (Askese) unterzogen haben. Auch der Weise hat viel von seinem Nimbus verloren. Es macht heute keinen Sinn mehr, von „bloßen Menschen“ zu sprechen: Es gibt nur noch bloße Menschen.
Alle Menschen sind im Prinzip gleich – aber nicht als Gotteskinder, sondern gleich vor dem Genom. Und diese können jetzt – z. B. dank NLP und von einer neuen Vorannahme ausgehend – ihre Selbstoptimierung vorantreiben: Jeder kann alles lernen! „If you can dream it, you can do it.“ Wir sehen: Die Überspanntheiten sind vom alten Europa in die USA geschwappt – und kommen jetzt als Reimport zu uns zurück.
Im Übergang vom 18. zum 19 Jahrhundert entsteht in der deutschen Romantik (Novalis) wiederum eine Idee von der Ästhetik der Existenz, aber doch mit einem ganz anderen Akzent im Vergleich zu der Vorstellung der Griechen: Der große Mensch ist der, dessen Biographie selbst das größte Kunstwerk ist. Das Leben wird hier nur als Material für das Leben benutzt. Was als Kunstwerk soll bestehen, muss im Leben untergehen. (Schiller, Die Götter Griechenlands)
Diese Untergangsfantasien scheinen uns Heutigen eher wenig verlockend: Wir wollen doch, wenn wir überhaupt an Traditionen anknüpfen wollen, eher an eine Ästhetik der Existenz anknüpfen. Wir wollen ein schönes und gelungenes Leben – und uns weder von der Religion noch der Politik oder der Wissenschaft vorschreiben lassen, wie dieses auszusehen hat. Wir erwarten von unseren Trainern eher Techniken, die uns mit der nötigen Neutralität in die Lage versetzen, die Struktur unserer subjektiven Erfahrung zu verstehen und diese zielorientiert zu verändern. Dabei haben wir nach 40 Jahren NLP gelernt, dass zwar die einzelne Intervention nur wenig Zeit beansprucht, wir uns aber in unserer Selbstsorge auf einen lebenslangen Prozess einstellen sollten.
NLP im Rahmen einer 2.500 Jahre alten Traditionslinie der Sorge um sich selbst zu sehen verortet den NLP-Trainer neben Sokrates, Epiktet und Seneka, und die Teilnehmer der Ausbildungskurse sehen sich in einer langen Reihe von Menschen, die begriffen haben, dass Zur-Welt-Kommen für einen Menschen noch nicht genug ist, um ein Mensch im emphatischen Sinn zu werden. Schon die alten Philosophen haben von ihren Schülern Geld genommen, um ihnen beizubringen, wie sie sich am besten um sich selbst kümmern können; manche sind schon damals dabei verarmt, ohne dass ihre Fortschritte mit den angekündigten Zielen Schritt halten konnten (Hermetismus). Und so ist auch der moderne Lernen- Wollende auf der Suche nach dem richtigen Lehrer vor enttäuschenden Erfahrungen nicht gefeit.
Wie jede Kunst bedarf auch die Lebenskunst eines Materials, und dieses Material ist das Leben selbst. Lebenskunst ist „eine fortwährende Arbeit der Gestaltung des Lebens und des Selbst.“ Kunst wird hier als ein Können in dreifacher Hinsicht verstanden:
Erschließung von Möglichkeiten
Können im Sinn der Realisierung von Möglichkeiten (Know-how)
Können im Sinn der kunstvollen Realisierung von Möglichkeiten – also „gekonnt“ im eigentlichen Sinne.
Das Leben als Kunstwerk bzw. die Lebenskunst ist in dieser Weise ein „work in progress“. Das Wesentliche dabei ist nicht eine Suche nach dem eigentlichen/wahren Selbst (wie dieses auch immer bestimmt sein mag), sondern der Akt des Etwas-aus-sich-Machens. In diesem Prozess liegt selbstverständlich zugrunde, dass jede Wahl auch eine Zurückweisung einer anderen möglichen Wahl darstellt … und dass die Ungewissheit darüber, ob diese nicht die bessere gewesen wäre, unauflöslich bleibt. Keine noch so raffinierte Timeline-Arbeit wird daran je etwas ändern. Zudem liegt jedem dieser Wahlakte ein Wert zugrunde, den wir dadurch realisieren wollen. Ob er aber durch die Entscheidung realisiert wird, wird sich immer erst nach der Wahl zeigen.
NLP kann mit seinen Möglichkeiten an diese drei Aspekte anknüpfen und in diesem Sinn als eine Technik der Lebenskunst verstanden werden. Und wenn mich die Rückmeldungen aus meinen Seminaren nicht ganz täuschen, dann ist es auch gerade dieser Aspekt, der NLP für so viele Menschen interessant macht. Die Frage, die dann aber immer noch zur Beantwortung ansteht, lautet: Was für eine Art von Lebenskunst meinen wir: eine Art Lifestyle, den man kaufen kann, eine Art postmodernes Existenz-Design, das die soziale Selbstinszenierung von Individuen meint – oder handelt es sich um eine ernsthafte Arbeit an sich selbst, die realisiert hat, dass es keine unendliche Daseinserleichterung gibt … eine Arbeit, die alle Register menschlicher Erfahrungsmöglichkeiten – von den tragischen bis zu den ekstatischsten, von der Alltäglichkeit des Dahindümpelns bis zu den seltenen Momenten spiritueller Erleuchtung – umfasst?


