Die Logischen Ebenen im NLP
Klaus Grochowiak
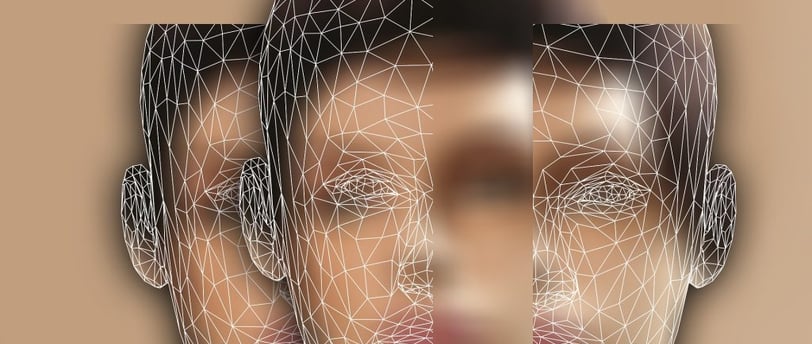
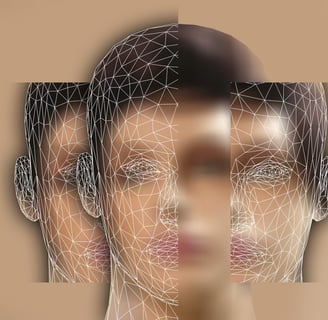
Das Konzept der Logischen Ebenen wurde von Robert Dilts 1990 (Changing Beliefs with NLP) ins NLP eingeführt. Seitdem hat dieses Konzept eine gewisse Popularität unter NLP’lern erworben. Es scheint uns daher wichtig, dieses Konzept etwas näher unter die Lupe zu nehmen. Bevor wir dies allerdings tun, hier noch eine kurzer Hinweis die theoretische Kritik stellt nicht grundsätzlich die Nützlichkeit dieser Einteilung bei der therapeutischen Arbeit in Frage.
Beginnen wir mit einer kurzen Zusammenfassung des Modells, so wie es von Dilts dargestellt worden ist.
“Die Idee von logischen Ebenen bei der Veränderung von Glaubenssätzen als Basiskonzept leitet sich von Gregory Batesons Anwendungen logischer Ebenen in seinem Studium über Systeme und über Schizophrenie her. Und ein großer Teil der Inspiration für die Methoden der Anwendung dieser Ideen wurde aus der innovativen Arbeit von Dr. Milton H. Erickson abgeleitet.”
Batesons Lerntheorie ist inspiriert von der logischen Typentheorie von Russel und Whitehead. Diese Theorie hat am Anfang dieses Jahrhunderts einen wesentlichen Beitrag zur mathematisch-logischen Grundlagenkrise geleistet. Man hatte entdeckt, daß eine rigorose Untersuchung der logischen Grundlagen der Mathematik zu verschiedenen Paradoxien führte. Die Principia Mathematica von Russell und Whitehead war ein Versuch, aus dieser Krise einen Ausweg zu weisen. Um zu verstehen, worum es dabei geht, möchte ich hier ein einfaches Beispiel einer solchen Paradoxie anführen.
Man kann nicht nur die Mathematik, sondern auch die Informatik und jegliche Begriffskonstruktion mengentheoretisch auffassen. Dies bedeutet, daß die gesamte “Welt” (der Bereich des jeweiligen Diskurses) aus Elementen und Mengen besteht. Jede Eigenschaft konstituiert eine Menge. Beispiel: “ROT” konstituiert die Menge all dessen, was rot ist. Nun ist “Menge sein” sicherlich auch eine Eigenschaft. Also kann die “Menge aller Mengen” gebildet werden. Daß es sich bei dieser Begriffsbildung aber um eine Paradoxie handelt, ist auch ohne aufwendigen mathematischen Beweis leicht anschaulich einsichtig. Wenn man sich, wie bei den Venn-Diagrammen, eine Menge als einen Kreis vorstellt, in dem die Punkte die Elemente der Menge sind, dann wäre die “Menge aller Mengen” der Kreis, der um alle anderen Kreise herumgezogen wird. Dadurch ist aber eine neue Menge entstanden, die nicht in der “Menge aller Mengen” enthalten ist. Was im Widerspruch zur Definition der “Menge aller Mengen” steht. Eine ähnliche Situation entsteht bei der bekannten Russelschen Antinomie.
Die Typentheorie von Russel und Whitehead “löst” das Problem nun derart, daß sie vorschreibt, daß keine Menge Element ihrer selbst sein darf, daß eine Menge von Mengen nicht eine der Mengen sein kann, die ihre Elemente sind; daß ein Name nicht die bezeichnete Sache ist.
Eine weitere Behauptung dieser Theorie ist, daß eine Menge nicht eine jener Einheiten sein kann, die zutreffend als ihre Nichtelemente klassifiziert werden.
Nehmen wir die Klasse der Stühle, dann gehören Tische und Lampenschirme zur Klasse der Nichtstühle, aber die “Menge der Stühle” gehört nicht zur Menge der Nicht-Stühle, obwohl sie sicherlich kein Stuhl ist, aber sie ist als Menge eine logische Ebene bzw. einen Typ höher.
Bateson geht nun davon aus, daß diese Erkenntnisse der logisch-mathematischen Grundlagenforschung in den Sozial- und Biowissenschaften berücksichtigt werden müssen, wenn der historische Stand kritischer Reflexion nicht hinter dem historisch erreichten zurückbleiben soll.
Es ist hier nicht der Ort, um darauf im einzelnen einzugehen, aber soviel sei doch gesagt, daß die Erkenntnisse der logisch-mathematischen Grundlagenforschung und namentlich der Kybernetik 2. Ordnung zu dem Ergebnis gekommen sind, daß eine Logik, die in der Lage ist, die Komplexität lebender Systeme auch nur einigermaßen
angemessen abbilden zu können, prinzipiell jenseits der klassischen zwei-wertigen Logik angesiedelt sein muß. D.h., die Typentheorie, so nützlich sie auch ist, wird der Komplexität lebender, selbstreferentieller Organismen nicht gerecht. Darauf geht Bateson in gewisser Weise am Ende seines Aufsatzes selbst ein.
“Das in diesem Aufsatz diskutierte Modell geht stillschweigend davon aus, daß die logischen Typen in Form einer einfachen, unverzweigten Stufenleiter angeordnet werden können. Ich glaube, daß es klug war, mit dem Problem zu beginnen, die ein solches Modell aufwirft.
Aber die Welt des Handelns, der Erfahrung, der Organisation und des Lernens läßt sich nicht vollständig auf ein Modell abbilden, das Aussagen über die Relation zwischen Mengen von verschiedenen logischen Typen ausschließt.
Wenn M1 eine Menge von Aussagen ist und M2 eine Menge von Aussagen über die Elemente von M1; dann ist M3 eine Menge von Aussagen über die Elemente von M2; wie aber sollen wir dann Aussagen über die Relation zwischen diesen Mengen klassifizieren? Beispielsweise kann die Aussage >Wie sich die Elemente von M1 zu den Elementen von M2 verhalten, so verhalten sich auch die Elemente von M2; zu den Elementen von M3 < nicht innerhalb der unverzweigten Stufenleiter von Typen klassifiziert werden.”
Bevor wir weitergehen, sei hier schon darauf hingewiesen, daß diese selbstkritische Einschränkung Batesons über sein Modell der logischen Ebenen bei Dilts nicht weiter aufgenommen worden ist.
Mehr noch, selbst in der Mathematik spielt die Typen-Theorie verglichen mit axiomatischen Ansätzen eine rein historische Rolle, d.h. dieser Ansatz hat sich für die Mathematik selbst als nicht besonders produktiv erwiesen. Insofern könnte man sagen ist eine Anknüpfung gerade an diesen Teil der mathematischen Grundlagenforschung obsolet; um so mehr, als es andere Konzepte gibt, die den Bedürfnissen einer Theorie selbstreferentieller Systeme viel näher liegen.
Was bedeuten die logischen Ebenen in der mathematischen Logik?
Um diese Frage zu beantworten möchte ich den Erfinder dieser Theorie selbst zu Worte kommen lassen. Russel schreibt in seinem Buch “Die Philosophie des Logischen Atomismus” in dem Kapitel “Mathematische Logik auf der Basis der Typentheorie”:
Russell und Whitehead gehen davon aus, daß die Ursache für die gefürchteten Antinomie und Paradoxien in der Mathematik und Logik “ein gemeinsames Merkmal, daß wir als Selbstbezug oder Reflexivität beschreiben können”, haben.
D.h., mit anderen Worten, daß das Projekt der Typentheorie ein Projekt ist, daß sich mit den Folgen selbstreferentieller Strukturen in mathematischen, d.h. irreflexiven Theorien beschäftigt. Die Übernahme eines solchen Konzepts ist gleichbedeutend mit der Zustimmung zu einer Immunisierungsstrategie gegen Selbstreferentialität. Dies ist für die klassische Mathematik ein durchaus legitimes Anliegen, allerdings ist eine kritiklose Übernahme eines solchen Konzepts für eine Theorie lebender Systeme, deren elementarste Charakteristik gerade ihre Selbstreferentialität ist, äußerst fragwürdig.
Und dabei ist es ein historischer Unterschied, wenn Bateson 1964 darauf aufmerksam macht, daß die Typentheorie und die damit zusammenhängende Unterscheidung von Objekt- und Metasprache, von den Sozialwissenschaften zur Kenntnis genommen werden sollte und wenn Dilts 1990, nachdem es eine 30jährige Debatte über Selbstreferentialität in der Kybernetik, in der systemisch orientierten Familientherapie, in der biologischen Theorie Maturanas über autopoietische Systeme u.v.a., als hätten diese Entwicklungen nicht stattgefunden, seine Version
der “Logischen Ebenen in Organisationen” vorstellt.
Juristisch formuliert könnte man sagen, daß man hier die Unschuldsvermutung nicht mehr gelten lassen kann. Warum sagen wir dies an dieser Stelle so deutlich und wenig freundlich? Um darauf hinzuweisen, daß sich das NLP, nicht nur was die Konzeption der Logischen Ebenen angeht, von der weltweit geführten Diskussion abgekoppelt hat und gleichzeitig intern den Mythos von der Avantgarde pflegt. Es wird unserer Meinung nach höchste Zeit, daß im NLP eine Diskussion beginnt, die sich mit dem auseinandersetzt, was heute weltweit gedacht, geforscht und
ausprobiert wird. Um dies ganz klar zu sagen: Nicht nur was so exotisch anmutende Themen wie die Logischen Ebenen angeht, ist NLP von der internationalen Diskussion abgekoppelt.
Um eine anderes Beispiel zu geben:
Wo wurde im NLP die Nach-Chomskyanische Linguistik rezipiert und für die NLP-Praxis (Meta-Modell) entsprechend modelliert? Wenn man wissen möchte, wie dies geht, dann kann man z.B. Steve de Schazers Ansatz studieren, in dem z.B. die dekonstruktionistische Kritik Derridas an Chomsky für eine kurzzeittherapeutische Interviewtechnik nutzbar gemacht worden ist.
Doch kommen wir zurück zu den logischen Ebenen und zu unserer Frage:
WAS IST EIGENTLICH EINE LOGISCHE EBENE?
“Ein Typ ist definiert als Signifikanzbereich einer Aussagefunktion, d.h., als Menge der Argumente, für die die fragliche Funktion Werte hat.” …
“Keine Gesamtheit kann Elemente enthalten, die durch diese selbst definiert sind. Dieses Prinzip wird in unserer technischen Sprache zu : >Was immer eine gebundene Variable enthält, kann kein möglicher Wert dieser Variablen sein>. Daher muß, was immer eine gebundene Variable enthält, anderen Typs sein, als die möglichen Werte dieser Variablen. Wir sagen, daß es höheren Typs ist. “ (Russel, Logischer Atomismus, S. 38)
Typ ist hier nur eine andere Formulierung für Logische Ebene.
“Elementare Aussagen und solche, die nur Individuen als gebundene Variablen enthalten, werden wir Aussagen erster Ordnung nennen.(…) Wir haben so eine neue Gesamtheit, nämlich die der Aussagen erster Ordnung. Wir können nun neue Aussagen bilden, in denen Aussagen erster Ordnung als gebundene Variablen vorkommen. Sie werden Aussagen zweiter Ordnung genannt.” (S.39)
Worum geht es also bei der Typentheorie? Grundsätzlich geht es dabei um eine Klassifizierung von logischen Objekten, die eine ganze Hierarchie von Typen bilden. Individuen sind Objekte des 0-ten Typus, Eigenschaften (bzw. Klassen) von Individuen sind Objekte des 1-ten Typus, Eigenschaften von Klassen 1-ten Typus, Eigenschaften von Eigenschaften 1-ten Typus usw. sind Objekte des 2-ten Typus, usw.
Der Grund, der zur Formulierung der Typentheorie bzw. der Theorie der logischen Ebenen geführt hat, besteht also kurz gesagt darin, daß Aussagen über Aussagen logisch gesehen problematisch sein können und zu Paradoxien und Antinomien führen können, was die Operativität eines mathematischen Systems zerstört. Die Unterscheidung von Objekt und Metasprache, die eine Folge der Typentheorie darstellt, ist also der Versuch, ein solches Sprechen wieder unter Kontrolle zu bringen. Ob es allerdings für Nicht-Mathematiker, namentlich für Therapeuten sinnvoll ist, sich an einem derartigen Versuch zu beteiligen, soll hier ausdrücklich bestritten werden.
Oder anders gesagt: Selbstreferentialität oder Selbstthematisierung wird hier in den unendlichen Regreß der Typen-Hierarchie verbannt.
Dilts führt sein Konzept mit folgenden Worten ein:
“Das Gehirn ist wie jedes biologische oder soziale System in Form von Ebenen organisiert. Das Gehirn hat verschiedene Verarbeitungsebenen. Das ist der Grund, weshalb verschiedene Ebenen des Denkens und des Seins existieren. Wenn wir das Gehirn verstehen oder Verhaltensweisen verändern wollen, müssen wir uns mit diesen unterschiedlichen Ebenen befassen. Das gleiche gilt auch innerhalb des Systems eines Unternehmens, in welchem es verschiedene Organisationsebenen gibt.”(R. Dilts, Die Veränderung von Glaubenssystemen, S. 15)
Schauen wir uns diese Einleitung einmal etwas näher an.
Logische Ebenen und Gehirn
Es geht also ums Gehirn und seine Ebenen! Was sind die Ebenen des Gehirns?
Darüber belehrt uns Dilts am Ende seines Buches:
“III. Neurologische Ebenen
Diese verschiedenen Ebenen versetzen jeweils ein tieferes Engagement (commitment) der neurologischen “Schaltkreise” in Aktion.
Spirituell: Holographisch – das Nervensystem als Ganzes
A. Identität: Immunsystem und endokrines System – tiefe lebenserhaltende Funktionen
B. Glaubenssätze: Autonomes Nervensystem (d.h., Herzschlag, Pupillenerweiterung, usw.) – unbewußte Reaktionen
C. Fähigkeiten: Kortikale Systeme – halbbewußte Aktionen (Augenbewegungen, Haltung, usw.)
D. Verhaltensweisen: Motorisches System (pyramidales System und Zerebellum) – bewußte Aktionen
E. Umgebung: Peripheres Nervensystem – Empfindungen und Reflexreaktionen” (Dilts, S. 220)
Dies sind sie nun die “Neurologischen Ebenen”?!
Man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll.
Wenn ein Mensch also an seine spirituellen Werte, an sein Eingebettetsein in das Große Ganze denkt und dabei die entsprechende Kinästhetik hat, dann ist “das Nervensystem als Ganzes” aktiv! – Und sonst nicht? Warum und wieso das Nervensystem auf ein Thema bzw. einen thematischen Bereich anders reagieren sollte, als auf einen anderen, will mir bei meinen neurophysiologischen Kenntnissen beim besten Willen nicht einleuchten. Oder soll das Nervensystem nur holographisch funktionieren, wenn ich ein spirituelles Erlebnis habe? Fragen über Fragen – aber man weiß es eben nicht!
Wie ist es nun mit der Identitätsebene? Nun, wenn sie weniger ist, als das Nervensystem im Ganzen, kann sie tatsächlich nur ein untergeordneter Teil sein. Aber was für einer? Immunsystem und endokrines System.
Wie aus den nebenstehenden Text (Immunsystem) entnommen werden kann, ist a) das Immunsystem kein Teil des Nervensystems und b) sind die endokrinen Drüsen als ein Teil des vegetativen Nervensystems nicht gerade auf einer besonders “hohen” Ebene angesiedelt. Aber davon abgesehen soll doch nicht ernsthaft behauptet werden, daß diese Systeme nur aktiv sind, wenn es thematisch um Fragen unserer Identität geht? Oder doch?
Nun kann man allerdings mit Recht behaupten, daß das Immunsystem etwas mit unserer körperlichen Identität zu tun hat, da es eben fremdes Material aussondert und so unsere Integrität sicher stellt. Aber mir ist der Zusammenhang mit dem was Dilts, die Identitätsebene (mission) nennt, völlig schleierhaft.
Und wie ist es mit der Ebene der Glaubenssätze? “Autonomes Nervensystem – unbewußte Reaktionen”. Man hätte doch denken können, daß an Glaubenssätzen vielleicht auch das Gehirn beteiligt ist – aber das gehört nun leider zum zentralen Nervensystem! Schade! Natürlich haben Glaubenssätze, wenn sie aktiviert werden auch Wirkungen auf den Herzschlag usw., doch dies haben alle möglichen mentalen Prozesse, die nun aber gar nichts mit Glaubenssätzen zu tun haben. Und unbewußte Reaktionen begleiten alles mögliche und sind in keiner Weise spezifisch für Glaubenssätze.
Kommen wir jetzt zu Fähigkeiten! “Kortikale Systeme – halbbewußte Aktionen”.
Warum eigentlich nicht auch unbewußte sowie auch bewußte Tätigkeiten? Oder anders gefragt: Was sind eigentlich “Fähigkeiten” auf der Ebene des Nervensystems? Sind dies nicht neurologische und neuro-muskuläre Muster? Also eher etwas Potentielles? Augenbewegungen sind in meinem Verständnis eher Handlungen, die, damit sie überhaupt ausgeführt werden können, auf bestimmte neuromuskuläre Muster angewiesen sind. Diese könnte man dann “Fähigkeiten” nennen.
Die Umgebung ist jetzt auch schon eine “Neurologische Ebene”? Oder ist mit “peripheres Nervensystem – Empfindungen und Reflexreaktionen” der Kontakt mit der Umgebung gemeint? Wenn ja – der findet allerdings schon auf der Ebene des Verhaltens statt.
Nach diesem abschreckenden Beispiel von pseudo-neurophysiologischen Erklärungen hier, als kleines Kontrastprogramm, eine Literaturempfehlung, die zeigt wie man Psycho-Neuroimmunologie und Neurophysiologie mit Therapieforschung kombinieren kann:
“Ernest L. Rossi, The Psychobiology of Mind-Body Healing – New Concepts of Therapeutic Hypnosis”
Soviel zum ersten Satz der Einleitung: “Das Gehirn ist wie praktisch jedes biologische oder soziale System in Form von Ebenen organisiert.
Und weiter geht es im Text: “das ist der Grund, weshalb verschiedene Ebenen des Denkens und des Seins existieren.”
Sind diese “Ebenen des Denkens” den oben genannten Gehirnebenen zugeordnet? So daß jede Ebene für eine Ebene des Denkens zuständig ist? Nun, dies wäre in der Tat eine recht originelle neue Theorie über den Zusammenhang von Gehirnanatomie und Kognition.
Oder sind die Ebenen des Denkens unabhängig von denen des Gehirns? Aber warum wird dann das Gehirn erwähnt? Aber die Verarbeitungsebenen des Gehirns sollen nun auch noch für die verschiedenen Ebenen des Seins zuständig sein. Nun, ein Blick ins englische Original nimmt uns etwas den philosophischen Schock, denn hier heißt es etwas weniger ambitiös:
“As a result you can have different levels of thinking and being.”
Mit “being” ist hier nicht gleich das SEIN im Ganzen gemeint sondern wohl eher das Dasein oder schlicht die Erlebnis- und Verhaltensweisen des Menschen. Soll damit angedeutet sein, daß die Ebenen “Verhalten”, “Fähigkeiten”, “Glaubenssätze/Werte” und “Identität” eine angebbare Beziehung zu irgendwelchen Ebenen im Gehirn haben? Wenn ja, dann hätte man als interessierter Leser doch gerne gewußt, auf welche Untersuchungen sich Dilts hier bezieht. Ich möchte mich anheischig machen zu behaupten, daß diese Behauptung durch keinerlei neuropsychologische Forschung abgesichert ist.
Warum nicht ganz einfach “Ebenen der Intervention”? Denn als solche sind sie in der Tat “für jeden, der im Bereich der Vermittlung von Fähigkeiten (des Lernens), der Kommunikation oder der Verhaltensveränderung arbeitet, sehr wichtige Differenzierungen.” (Dilts, S.16)
Dem können wir uneingeschränkt zustimmen.
Nun und was ist an diesen Ebenen letzten Endes “logisch”?
“I. Logische Ebenen
Gregory Bateson hat darauf hingewiesen, daß es bei den Prozessen des Lernens, der Veränderung und der Kommunikation, natürliche Hierarchien der Klassifikation gebe. Die Funktion jeder Ebene sei es, die Information auf der darunterliegenden Ebene zu organisieren, und die Regeln, nach denen etwas auf einer bestimmten Ebene geändert werde, unterscheiden sich von jenen, nach denen auf einer darunter liegenden Ebene etwas geändert würde. Eine Änderung auf einer der unteren Ebene könnte, müsse aber nicht unbedingt, die darüber liegenden Ebenen beeinflussen; doch etwas auf den oberen Ebenen zu verändern, verändere notwendigerweise Dinge auf den darunterliegenden Ebenen, um die Veränderung auf den höheren Ebenen zu unterstützen. Bateson bemerkte, daß Probleme häufig durch Verwechseln der logischen Ebenen entstünden.”
Uns wäre allerdings angesichts dieses Satzes (der leider im englischen Original kein bißchen verständlicher ist) schon mit einfacher, logischer Folgerichtigkeit in einem Satz gedient.
Dilts erläutert, was er damit meint wie folgt:
“Ich verändere meine Umgebung oder wirke auf sie ein mit Hilfe meines Verhaltens. Um mein Verhalten zu verändern, muß ich auf der Ebene darüber sein; der der Fähigkeiten.
Ich kann mein Verhalten nicht wirklich verstehen oder es verändern, ehe ich nicht über ihm bin.
Die Ebene der Fähigkeiten könnte man mit dem Puppenspieler vergleichen, der eine Marionette führt.
Um eine Fähigkeit zu verändern, muß ich auf der nächsthöheren Ebene sein; auf der Ebene der Glaubenssätze.
Und um einen Glaubenssatz zu verändern, um aus dem Einflußbereich meiner Glaubenssätze herauszukommen, so daß ich sie mir wirklich anschauen und sie verändern kann, muß ich anfangen, aus meiner reinen Identität heraus zu operieren.” (Dilts, S. 67-68)
Mit unserem Verhalten wirken wir auf die Umgebung ein!
O.K. dies ist sicherlich unstrittig.
Um unser Verhalten zu verstehen oder es zu verändern, müssen wir auf der Fähigkeiten-Ebene sein? Und die ist wie ein Puppenspieler? Oh je!
“Fähigkeiten” ist, wie unschwer zu erkennen ist, eine Nominalisierung. Wenn wir diese entnominalisieren, landen wir bei “fähig-sein-zu”, z.B. Ski zufahren. Ski-fahrenkönnen ist eine Fähigkeit und Ski fahren eine Handlung oder ein Verhalten. Wenn ich also mein Verhalten (z.B. Wedeln) verbessern will, muß ich auf der Fähigkeiten Ebene sein?
Was soll dieser Satz bedeuten? Er ist semantischer Unsinn! Ist es nicht vielmehr so, daß mir mein Skilehrer einen Hinweis gibt, den ich dann in Form von Übungen (Verhaltensebene) umsetze? Sollte dies gut gelingen hat sich meine Fähigkeit, zu wedeln, verbessert. Für diese Verbesserung mußte ich aber nicht auf die “Verhaltensebene”. Aus dieser Nominalisierung macht Dilts dann anschließend gleich noch ein apartes Wesen, einen Puppenspieler. So als ob meine neuromuskulären Muster mich beim Skifahren steuern. Ist es nicht vielmehr so, daß ICH diese nutze? Inwiefern kann man sagen, daß ein Kleinkind, wenn es laufen lernt auf der Ebene der Fähigkeiten ist?
Wenn wir Verhalten, z.B. durch Ankerverschmelzen verändern, war der Klient dann auf der Fähigkeitenebene?
Solche Formulierungen sind die Folge, wenn man innere Prozesse nominalisiert:
Fähigkeiten-EBENE.
Und warum muß ich auf die “Fähigkeiten-Ebene”, wenn ich mein Verhalten verstehen will? Wenn ich z.B. verstehen will, warum ich mich schönen Frauen gegenüber besonders unsicher verhalte, und mit Hilfe eines Suchankers in die Vergangenheit gehe und einige unangenehme Erlebnisse aus der Pubertät wieder ins Bewußtsein bringe, um dies dann zu ändern, bedeutet das “ich war auf der Fähigkeiten-Ebene”?
Und um Fähigkeiten zu verändern, muß ich keinesfalls auf die Glaubens-Werte- Ebene. Es reicht, daß ich etwas Neues übe und damit neue Fähigkeiten erwerbe. Natürlich gibt es den Fall, in dem das Erwerben dieser neuen Fähigkeiten voraussetzt, daß ich einen limitierenden Glaubenssatz, der z.B. behauptet, “das lern ich sowieso nie” verändere. Aber dies ist durchaus nicht immer notwendig, um neue Fähigkeiten zu erwerben. Aber selbst wenn ich auf der Ebene der Werte- und Glaubenssätze sozusagen die Voraussetzungen dafür schaffe, daß ich es für
sinnvoll, erstrebenswert und möglich halte, eine bestimmte Fähigkeit zu erwerben, so erwerbe ich sie nicht dadurch, daß ich auf dieser Ebene bleibe, sondern dadurch, daß ich auf der Verhaltensebene etwas neues tue.
Wie ist es nun mit den Glaubenssätzen? Um diese zu verändern, muß ich angeblich aus dem Bereich der “reinen Identität heraus operieren”. Abgesehen davon, daß mir nicht klar ist, was der Unterschied zwischen Identität und “reiner Identität” sein soll, ist auch der hier behauptete Zusammenhang durchaus nicht einsichtig.
Wenn ich z.B. glaube, daß vegetarische Ernährung gesünder ist als nicht vegetarische oder umgekehrt, dann kann dieser Glaubenssatz z.B. durch ein Studium der Ernährungswissenschaften, das Lesen eines Buches, usw. verändert werden, ohne daß ich meine Identität, meine Mission neu überdenken müßte.
Was versteht Dilts unter IDENTITÄTSEBENE?
“Auf der Ebene der Identität könnte der Lehrer sagen: ‘Du bist ein schlechter Student’ oder ‘Du bist ein Mensch mit Lernschwierigkeiten’ oder ‘Du bist ein schlechter Mathematiker’. Derartige Aussagen beziehen sich auf das gesamte Sein des Kindes.”
Identität als innere Einheit der Person kann also höchstens in dem Satz ausgedrückt werden: ICH bin ICH.
Und selbst bei diesem Satz wäre noch zu bedenken, daß es ein Ich geben muß, das diesen Satz denkt bzw. aussagt.
Werden aber auf der sogenannten Identitätsebene Sätze der Form:
Ich bin ein Forscher.
Ich bin ein Alkoholiker.
Ich bin Mann, Vater, Deutscher usw.
zugelassen, dann stellt sich doch die Frage was macht eine Selbstcharakterisierung nach Dilts Meinung zu einer auf der “Identitätsebene”?
Die Tatsache, daß der Satz mit “Ich bin” anfängt? Was wäre dann mit dem Satz “Ich bin zu spät gekommen”? Oder “Ich bin Brillenträger”.
Was, wenn man statt “Ich bin Alkoholiker” sagt “Ich habe ein Alkoholproblem”?
Verändert sich dann etwas? Und wenn ja was?
Nun könnte man sagen Dilts intendiert mit dieser Sprechweise so etwas, wie das Wesentliche, das was einen Menschen im Kern ausmacht, was von ihm nicht wegzudenken ist, ohne daß er nicht mehr der Selbe wäre, wenn dieses sich verändern würde.
Oder meint er mit “Identitätsebene” so etwas wie Eigenschaften, die all mein Handeln und Erleben ständig begleiten, so etwas, wie eine Daseinsgrundbefindlichkeit? Wir wissen es nicht. Mir scheint aber aus all dem Gesagten deutlich zu sein, daß die ganze Redeweise von den Ebenen zu einer stark verdinglichenden Denkweise führt. D.h. was bei unerwünschter Charakterisierung auf der Identitätsebene tatsächlich gemacht wird, ist ein Reframing auf die Verhaltensebene. D.h. statt Du bist ein schlechter Mathematiker wird jetzt gesagt, daß X Schwierigkeiten beim rechnen hat. Dies ist in der Tat schon eine angenehmere Formulierung. Allerdings kann man dies mit gleichem Recht mit allen “positiven” Selbstcharakterisierungen auf der Identitätsebene ebenso tun.
Denn so wie Dilts die Identitätsebene konzipiert, findet bei der Therapie keine strukturelle Veränderung der Selbstthematisierung statt, sondern es wird ein Etikett durch ein anderes, vermeintlich wünschenswerteres, ausgetauscht. Nun wissen wir allerdings, spätestens seit Einstein, daß die Lösung eines Problems nicht auf der
gleichen “logischen Ebene” zu finden ist, wie das Problem bzw. die Problemdefinition. Insofern läuft Dilts Intervention auf eine moralische Verbesserung hinaus.
D.h. alle limitierenden Selbstthematisierungen werden zu Verhaltensweisen reframed und alle förderlichen zu solchen auf der Identiätsebene erklärt. Dies ist philanthropischer Voluntarismus, hat aber mit der Grundintention des NLP wenig zu tun. Bandler sagte Anfang der 70’er -sinngemäß- “es geht uns im NLP nicht darum aus unglücklichen Robotern glückliche zu machen, sondern Menschen zu helfen Wahlmöglichkeiten zu entwickeln, wo sie bis dato keine hatten.”
D.h. irgendwie hofft man, daß der Klient mit der Selbstdefinition “Ich bin ein Teil des Göttlichen” besser bedient ist, als mit der Selbstdefinition “Ich bin ein Alkoholiker”. Dies mag sogar auf der Ebene der subjektiven Befindlichkeit zutreffen, ist aber noch kein Beweis dafür, daß sich der Klient auf eine strukturell komplexere, angemessenere Art selbst thematisiert. Dieser Unterschied kann beim Diltsschen Ansatz gar nicht erst in Betracht kommen.
Hier wäre als erstes die als-Funktion einzuführen:
Ich als Vater
Ich als Alkoholiker
Ich als Heiler
usw.
Dem wäre entgegenzuhalten, daß er z.B. mit der Selbstthematisierung “Ich als Teil des Göttlichen erlebe mich als Alkoholiker und als Alkoholiker erlebe ich mich als ein Teil des Göttlichen”. Und ich gehe in keiner möglichen Selbstthematisierung auf. Selbst nicht in der, die sagt Ich bin derjenige, der sich auf immer wieder neue Art selbst thematisieren kann.
Dilts führt hier einen naiven und völlig unreflektierten Identitätsbegriff ein, bei dem sich jeder so ziemlich alles denken kann, da er kaum näher bestimmt wird. Insofern läßt sich hier beim besten Willen nichts weiterentwickeln. Wir werden an anderer Stelle zum Thema des SELBST, der Entnominalisierung des ICHs, der Selbstthematisierung usw. ausführlich Stellung nehmen. Daher möchte ich hier die Erörterungen über die Identitätsebene abbrechen.
Wo gehören die logischen Typen im NLP hin?
Überall dort, wo jemand eine kognitive Funktion (glauben, wissen, bewerten usw.) auf diese Funktion selbst anwendet, haben wir es mit dem Problem der Selbstreferentialität zu tun, welches Russel und Whitehead zur Formulierung ihrer Typen-Theorie veranlaßt hat. Für diese Fälle hat NLP allerdings schon zwei nützliche
sprachliche Interventionstechniken entwickelt.
Beispiel:
Klient: “Ich akzeptiere mich nicht!”
Diese Aussage meint etwas ausführlicher formuliert:
Für alle meine Erlebnis- und Verhaltensweisen gilt, daß ich sie nicht akzeptiere.
Nun ist die Aussage “Ich akzeptiere mich nicht!” allerdings selbst eine Verhaltens und Erlebnisweise. Also gilt:
Ich akzeptiere nicht, daß ich mich nicht akzeptiere.
Im NLP haben wir bisher für Sätze dieser Art zwei mögliche Strategien:
a.) Sleight of mouth bzw. Criteria Utilisation Pattern: Selbstanwendung
Ich verstehe, daß Du nicht akzeptieren kannst, daß Du Dich nicht akzeptierst.
Durch diese Selbstanwendung hat sich die Bedeutung des Satzes in sein Gegenteil verkehrt und der Sprecher ist verwirrt. Dies kann man nun ausnutzen um andere “vorteilhaftere” Selbstthematisierungen zu suggerieren, oder man gibt eher generelle Suggestionen, daß Verwirrung bekanntlich die Vorstufe zu einem neuen tieferen Verstehen ist usw.
Bei dieser Technik wird nicht konstruktiv im Sinne der Typentheorie eine Trennung von Objekt- und Meta-Sprache eingeführt, so daß es möglich wäre in diesem Sinn sinnvoll weiter über diese Aussage zu reden. Eine solche Redeweise einzuführen könnte eine mögliche und sinnvolle Erweiterung des Interventionsapparates des NLP sein.
b) Wir fragen den Klienten:
“Was genau kannst Du an Dir nicht akzeptieren?”
Durch dieses Chunk-down bringen wir den Klienten dazu über konkrete Erlebnis- und Verhaltensweisen zu sprechen, die dann natürlich auch viel leichter zu verändern sind mit der vorhandenen NLP-Technologie.
Diese Art zu fragen unterstellt, daß die übergeneralisierte Sprechweise des Klienten sowieso nicht dem entspricht, was er meint. D.h. wir gehen bei dieser Art zu fragen von der Vorannahme aus, daß es durchaus Aspekte des Verhaltens und Erlebens gibt, die der Klient akzeptiert, und daß die Behauptung, daß er alles an sich selbst nicht akzeptieren kann, nur eine Art der Dramatisierung darstellt.
Hier noch ein kleines Beispiel für die kognitive Funktion des Glaubens und Wissens:
“Ich glaube unsere GS sind nur Rationalisierungen für unsere Triebe!”
“Und für welchen Trieb ist dieser GS eine Rationalisierung?”
“Ich weiß, daß ich die Wirklichkeit nie so erkennen kann, wie sie ist, sondern immer nur Modelle oder Karten von ihr habe!”
“Dann ist dieses Wissen auch nur ein Modell, und die Aussage, daß alles Wissen nur ein Modell ist, als solche nicht sicher, sondern eben nur modellhaft. Was sagt sie aber dann?”
Ich möchte noch ein letztes Mal auf die “Logischen Ebenen” zu sprechen kommen.
Wenn sie schon nicht als “logische” Ebenen gelten können und ebenso nicht als neurologische Ebenen, vielleicht können sie dann wenigstens als eine hierarchische Klassifizierung der inneren Organisation gelten?
Kommen wir zur ersten Differenz: UMGEBUNG-VERHALTEN
Nun ist Verhalten sicherlich kein Chunk-up von Umgebung. Und Umgebung kein Chunk-down von Verhalten. Die Tatsache, daß wir mit unserem Verhalten auf die Umgebung einwirken macht dieses nicht zu einer extentional oder intentional übergeordneten Menge bzw. Klasse.
Desweiteren wird hier ein Umgebungsbegriff benutzt, der scheinbar unabhängig vom Verhalten existiert. Im Sinne der strukturellen Kopplung oder Batesons Begriff der Ökologischen Nische ist die Umgebung allerdings etwas, das durch die Interaktion mit dem lebenden System hervorgebracht wird.
Wie ist es mit FÄHIGKEITEN und VERHALTEN?
Bevor wir uns dies näher ansehen, möchte ich darauf hinweisen, daß Dilts hier eine Denkfigur aus dem transzendentalen Idealismus von Kant wiederholt, in dem er wie dieser jeder Handlung ein Vermögen (Fähigkeit) zuordnet, welches angeblich die Bedingung der Möglichkeit der Handlung sein soll. Die Hypostasierung solcher
inneren Instanzen durch Nominalisierung ist an anderer Stelle schon ausführlichst kritisiert worden; hier sei nur kurz darauf hingewiesen, daß Fähigkeiten und Fähigkeiten-Ebene sicherlich keine Erfahrungsgegenstände des subjektiven Erlebens sind, sondern ihre Existenz ausschließlich der begrifflichen Konstruktion verdanken und als solche für die Beschreibung des subjektiven Erlebens im Sinne des NLP völlig überflüssig sind.
Wenn wir diese Konstruktion allerdings erst einmal annehmen, dann kann man in der Tat Fähigkeiten als die Voraussetzung von Verhalten verstehen. Ob allerdings die Voraussetzung ein Chunk-up oder ein Chunk-down ist, dies ist nicht eindeutig. So ist eine Grafikkarte beim Computer die Voraussetzung dafür, daß ich eine Grafik
zeichnen kann. Wenn man wie Douglas R. Hofstadter (Gödel, Escher Bach) einenComputer auf verschiedenen Chunk-levels beschreibt, dann ist eine Anwendung sicherlich ein Chunk-up von Grafikkarte, weil es ein konkreteres Muster ist. Es ist aber auch ein Spezialfall einer Anwendung und insofern ein Chunk-down.
Wie ist es mit dem Verhältnis zwischen GLAUBENSSÄTZEN /WERTEN und FÄHIGKEITEN?
Glauben und Bewerten sind sicherlich Fähigkeiten und als solche spezielle Fälle von Fähigkeiten als ein Chunk-down kein Chunk-up.
Wie ist es mit dem Verhältnis von IDENTITÄT und GLAUBENSSÄTZE/WERTE ?
Nun um diese Frage zu beantworten hätte ich gerne gewußt wie der folgende Satz einzuordnen ist:
“Ich glaube nicht, daß ich soviel Wert bin wie andere!”
Man spricht hier gerne von einem Kern-Glaubenssatz oder von einem Glaubenssatz auf der Identitätsebene. Allein dies scheint hier zu genügen um klar zu machen, daß diese beiden Ebenen konzeptionell oder definitorisch nicht klar getrennt sind.
Aber auch mit den nebengeordneten Bestimmungen wie:
Deine STÄRKE, Dein VERSTAND, Dein HERZ, Deine SEELE, Dein GOTT, ist es nicht besser bestellt.
Fragt man Jemanden z.B.: “Was sind Deine Stärken?” Dann bekommt man als Auskunft Sätze wie:
“Ich bin ein guter Zuhörer!”
“Ich habe Geduld!”
“Ich habe Humor” usw.
Diese Sätze beschreiben nun allerdings eher Fähigkeiten als Verhalten.
Und inwiefern die Fähigkeiten der Verstandes-Ebene zugerechnet werden müssen ist ebensowenig klar, wenn man sich bewußt macht, wie viele Fähigkeiten Menschen haben können, die gar nichts mit dem Verstand zu tun haben.
Chunking und Beschreibung
Wenn wir komplexe Systeme beschreiben wollen, dann ist es immer möglich, dieses auf unterschiedlichsten Chunk-Leveln zu tun und für viele Aufgaben ist es sogar unumgänglich dies zu tun. Aufgrund unserer begrenzten Fähigkeit Informationen gleichzeitig bewußt zu verarbeiten müssen wir diese verdichten und raffen. Dieser Umstand ist im NLP bisher ausschließlich unter dem Gesichtspunkt von Miller (The Magical Number 7 ± 2) diskutiert worden.
Auf diesen wichtigen Aspekt hat allerdings schon Ashby (Principles of the self-organising System) und auch G. Günther in seinem Aufsatz “Das Bewußtsein als Informationsraffer” hingewiesen. Günther greift hier die Überlegungen von Ashby auf, der zeigt, daß die Informationsmenge, die in lebenden Systemen zu verarbeiten ist, super-astronomische Größenordnungen annimmt. Anschließend stellt er dann fest:
“Es ist einfach absurd, annehmen zu wollen, daß solche Zahlen noch qua Quantität von lebenden Wesen verarbeitet werden. Dafür sorgt schon >Bremermann’s limit<, gemäß dem infolge der granularen Struktur der
Materie Information nicht schneller als 1047 bit pro Gramm und Sekunde transmittiert werden kann. Unter diesen Umständen ist die Hypothese unausweichlich, daß in den besagten Systemen Mechanismen existieren, die große Quantitäten nicht als Quantitäten sondern unter anderen kategorialen Gesichtspunkten verarbeiten. In anderen Worten: der ‘Abstand’ zwischen unserer erstgenannten Zahl 16 (gemeint sind hier die 16 zweistelligen logischen Funktionen der klassischen zwei-wertigen Aussagenlogik, K.G.) und den letztgenannten Zahlen von Ashby, die in einer 100-wertigen Logik bereits überboten werden, ist unzureichend begriffen, wenn man ihn als quantitativ auffaßt. Hier schlägt “Quantität” in ‘Qualität” um.” (G. Günther, Bewußtsein als Informationsraffer, S. 4)
Wie diese Fähigkeit bei lebenden Systemen im einzelnen funktioniert, davon wissen wir noch sehr wenig. Allerdings wissen wir, wie sie beim Menschen funktioniert: es ist die Fähigkeit zur Abstraktion.
“Ein Abstraktionsprozeß aber ist unter kybernetischen Gesichtspunkten nichts anderes als ein Hilfsmittel, mit Informationsquantitäten fertig zu werden, die sich erstens rein additiv nicht mehr bewältigen lassen und in denen Quantitäten in einer praktisch unbeschränkten Anzahl von inkommensurablen Eigenschaftsdimensionen auftreten.” (Günther, S. 4)
Ein besonders einfaches Beispiel für die Darstellung oder Beschreibung auf unterschiedlichen Chunk-levels ist ein Fernsehbild. Wir können es auf der Ebene der einzelnen Bildpunkte oder als Ganzes betrachten. Auf der ersten Ebene sind wir sicherlich dort, wo das Bild aufgebaut wird, allerdings können wir auf dieser Ebene den Inhalt des Bildes nicht verstehen. Wir können keine übergeordneten Muster erkennen.
Bevor ich auf verschiedene Beispiele näher eingehe hier eine kurze Definition für Chunking oder “ballen”. Hier handelt es sich um eine Form der Abstraktion, d.h. es werden größere Informationsmengen zu einem einzigen Chunk zusammengefaßt. So können wir den Überblick über komplexe Systeme bekommen.
Ein anderes Beispiel wäre die Beschreibung eines Menschen. Wir könnten auf der Ebene der Atome und Moleküle beginnen, wie dies auch für bestimmte Aufgaben der Pharmakologie notwendig ist. Als nächstes können wir dann auf die Ebene der Zellen gehen, von da aus könnten wir zu Zellverbänden und Organen übergehen.
Der Zellbiologe hat eine geballte Vorstellung von dem, womit sich die Molekularbiologen sehr detailliert beschäftigen. D.h. jede Stufe ist gegen die darunter liegende bis zu einem gewissen Grad “versiegelt”. Natürlich “sickert” immer ein bißchen durch; ein Chemiker kann sich nicht völlig von der Physik abkoppeln und ein Biologe sich nicht von der Chemie.
Für die weitere Betrachtung möchte ich noch eine Unterscheidung zwischen zwei verschiedenen Systemtypen einführen:
“Es gibt zwei Typen von aus vielen Teilen zusammengesetzten Systemen, die sich in bedeutender Hinsicht unterscheiden. Da sind einerseits die Systeme, bei denen das Verhalten gewisser Teile dahin tendiert, das Verhalten anderer Teile aufzuheben. Daraus ergibt sich, daß es nicht allzu wichtig ist, was auf den tieferen Stufen geschieht, weil auf höherer Stufe fast alles sich ähnlich verhält. Ein Beispiel für ein System dieser Art ist ein mit Gas gefülltes Gefäß, in dem alle Moleküle auf sehr komplizierte mikroskopische Weise gegeneinander stoßen und prallen, aber insgesamt, vom makroskopischen Standpunkt aus gesehen, ist dies ein sehr ruhiges >stabiles< System mit einer gewissen Temperatur, einem gewissen Volumen und einem gewissen Druck. Sodann gibt es ein System, in dem die Wirkung eines einzigen Ereignisses auf tiefer Stufe sich zu enormen Konsequenzen auf hoher Stufe vergrößert. Ein solches System ist ein Flipper, bei dem der genaue Winkel, unter dem eine Kugel jeden “Bumper” trifft, für die Bestimmung ihres weiteren Wegs nach unten entscheidend ist.” (D.R. Hofstadter, Gödel,Escher, Bach, S. 329-330)
Desweiteren zeichnen sich komplexe Systeme dadurch aus, daß sie verschiedenste Epiphänomene hervorbringen:
“Epiphänomene gibt es in Hülle und Fülle. … Im menschlichen Gehirn gibt es Leichtgläubigkeit. … Ist die Leichtgläubigkeit in einem >Leichtgläubigkeits-Zentrum< im Gehirn lokalisiert?” (Hofstadter, S. 331)
Leichtgläubigkeit ist ein Epiphänomen, daß aus Struktur und Arbeitsweise des jeweiligen Gehirns entsteht, aber nirgends lokalisiert werden kann. So betrachtet beispielsweise der Kognitivist Zenon Pylyshn, daß die
inneren visuellen Bilder schlicht subjektive Epiphänomene grundlegender, symbolischer Rechenprozesse sind.
Dilts nutzt mit seinen “logischen Ebenen” also eine Darstellungsweise, die sich zwar bei objektiven Sachverhalten, wie z.B. einem Computer bewährt hat, die aber bei selbstreferentiellen, Strukturen wie der Subjektivität schon bei anderen Persönlichkeitstheorien versagte.
Warum? Nun, solche Strukturen lassen sich sinnvollerweise nicht hierarchisieren, weil ihre Beziehungen zirkulär oder heterarchisch sind. Dies ist zumindest ansatzweise bei Dilts durch die Doppelpfeile angedeutet. Diese sollen bedeuten, daß z.B. die Fähigkeiten das Verhalten hervorbringen, aber auch das Verhalten die Fähigkeiten “beeinflußt”. Also stellt sich als erstes die Frage, warum die Fähigkeiten über dem Verhalten stehen und nicht umgekehrt das Verhalten über den Fähigkeiten, da man mit guten Gründen sagen könnte, daß die Fähigkeiten nur dadurch entstehen können, daß wir sie durch unser Verhalten hervorbringen, bzw. entstehen lassen. Oder warum sie nicht nebengeordnet sind – ohne jede Hierarchie?
Die nächste Frage, die man stellen muß ist die, warum Dilts davon ausgeht, daß es keine direkte Beziehung zwischen Verhalten und z.B. Glaubenssätzen oder Werten geben soll. Wo doch die alltägliche Erfahrung zeigt, daß eine einzige Erfahrung einen neuen Glaubenssatz kreieren bzw. einen bestehenden außer Kraft setzen kann, ohne daß der “Umweg” über die Ebene der Fähigkeiten nötig wäre.
Es deutet also alles darauf hin, daß eine Darstellung des Zusammenhangs der verschiedenen Bereiche, Kontexturen in einer Hierarchie sachlich unangemessen ist.
Die “logischen Ebenen” und die NLP-Community
Was also ist von diesem Modell zu halten? Und wie kommt es, daß es sich in der NLP Community, trotz seiner gravierenden Mängel, einer gewissen Beliebtheit erfreut?
Hier scheinen mir mehrere Faktoren eine Rolle zu spielen:
1. Die suggestive Art, wie ein Modell in einem Seminar eingeführt wird kann leicht dazu führen, daß die therapeutische Kompetenz und das gute Resultat der Intervention als Qualitätsnachweis für die verwendeten
Modelle genommen werden.
2. Das Modell wird eingeführt mit Verweis auf Gregory Bateson, die Typen-Theorie, Russell und Whitehead, also mit Namen und Theorien, die unter NLP’lern vielleicht einen guten Klang haben, die aber kaum gekannt werden. Dies kann man als eine Art Einschüchterung oder name-dropping verstehen.
3. Und da es im NLP bisher nicht üblich war Konzepte theoretisch zu diskutieren, sondern man sich mit der Praktikabilität zufrieden gab, fiel es niemandem auf, daß das Modell völlig inkonsistent ist.
4. Da man im NLP aus anderen Kontexten Dschungel-Logik gewohnt ist, akzeptiert man sie auch an Stellen, wo sie völlig unangebracht ist.
Wenn ich diese Kritik in NLP-Kreisen vortrage höre ich oft folgende Reaktion:
Ja das stimmt natürlich alles, aber ich habe bei der Arbeit mit den Ebenen festgestellt, daß es ein sehr nützliches Schema ist um die Therapie zu organisieren.
Wenn jemand mit einer Limitation kommt, dann kann ich ihn fragen:
1. Was würdest Du in dieser problematischen Situation für angemessener halten, und was würdest Du lieber tun statt Deines symptomatischen Verhaltens und dem dazugehörigen inneren Erlebens.
Wenn er mir diese Fragen nach der Verhaltensebene sinnvoll beantworten kann, dann gehe ich einen Schritt weiter und frage:
2. Um dieses Verhalten hervorbringen zu können brauchst Du vielleicht Fähigkeiten, die Du noch nicht hast (Schlagfertigkeit, Ausdauer, etc.).
Wenn dies der Fall ist, dann können wir nachschauen, ob es einen speziellen Grund gibt, warum die Person diese Fähigkeiten noch nicht entwickelt hat. Z.B weil sie einen Limitierungen GS über ihre Möglichkeiten hat dies zu leisten, bzw. weil sie Werte hat unter deren Gesichtspunkt der Erwerb dieser Fähigkeiten sogar als bedenklich
erscheinen mag.
Je nach dem ob dies der Fall ist oder nicht können wir dann zu guter letzt noch fragen :
3. Da Du z.Z. dieses Verhalten und alles was dazu gehört noch nicht in der Lage bist hervorzubringen, was denkst Du über Dich?
Und was würdest Du über Dich wissen, wenn Du dieses Verhalten genauso leicht hervorbringen kannst, wie viele andere deiner Verhaltensweisen?
In dieser und ähnlicher Weise wird das Modell der logischen Ebenen in der beratenden und therapeutischen Praxis häufig mit Gewinn benutzt und es erscheint diesen Nutzern ganz und gar nicht einsichtig, warum man dies nicht weiter fragen können soll, nur weil die ganze Theorie und der Anspruch den Dilts an dieses Modell anhängt nicht konsistent sind.
Dies wäre ein völliges Mißverständnis unserer Argumentation. Natürlich kann man all diese Fragen stellen und wenn sie in einer gegebenen Beratungssituation förderlich sind, dann wäre es absurd zu sagen, daß man dies nicht benutzen sollte.
Etwas ganz anderes ist allerdings die doch sehr weitreichende Konzeption dieses Modells als einer Art “Persönlichkeitsmodell” des NLP ( vgl. auch den Aufsatz von H. Klein , “Zielarbeit auf allen Ebenen” im
MultiMind Nov/Dez. 1995,: “Für die praktische Arbeit mit Zielen ist es daher sehr sinnvoll, die verschiedenen logischen Ebenen im Zielentwurf anzusprechen, damit alle Persönlichkeitsanteile für die motivierende Zielerreichung aktiviert werden können.”) anzusehen.
Unsere Dekonstruktion des NLP geht von der Vorannahme aus, daß im NLP mehr gemacht wird, als den Beteiligten bewußt ist und – das was ihnen bewußt ist, ist theoretisch oft auf eine sehr einfache, wenn nicht gar unzulässig vereinfachende Weise verkürzt. Der Pragmatismus des NLP ist allerdings oft ein guter Schutz gegen die ansonsten schlimmen Folgen solcher Vereinfachungen.
So scheint es mir typisch für die Bewußtseinslage innerhalb der NLP-Community zu sein, daß jemand die obige Kritik an der Konzeption der logischen Ebenen liest und antwortet: “Ich habe das nie so eng gesehen, aber oft sind sie sehr hilfreich!” Um dann zur Tagesordnung überzugehen bzw. die “logischen Ebenen” nur noch in Anführungszeichen zu nutzen.
Der Mangel an Theorie bzw. die erklärte Theoriefeindlichkeit von Bandler und Grinder haben im NLP wie mir scheint durchaus sehr unterschiedliche Wirkungen entfaltet.
So kann einerseits eine Art Ultrapragmatismus beobachtet werden, oder wenn man es etwas schärfer formulieren möchte eine Art “Handwerkelei”, der jegliche Meta-Reflexion als überflüssige Intellektualisierung vorkommt; und die einen guten Schutz vor dogmatischer Verhärtung der “reinen Lehre” darstellt, die aber auf der anderen Seite auch zu einer völlig naiven Rezeption jedes Formats und jeglicher Vorgehensweise führt, da es gar keine Kriterien gibt, die eine solche Diskussion allererst ermöglichen würden.
Nun kann man sagen, daß dies übertrieben ist, da es immerhin die Kriterien der Nützlichkeit und der Ökologie gibt. Damit ist gemeint:
1. Nützlichkeit: Hilft die in Frage stehende Technik dem Klienten sein Ziel zu erreichen?
2. Ökologie: Stellt die Technik und ihre konkrete Anwendung sicher, daß durch die Zielerreichung nicht andere Ziele des Klienten beeinträchtigt werden.
NLP geht also von der Vorannahme aus, dass diese Meta-Kriterien für die Arbeit ausreichend sind.


