Denken und Wollen
Klaus Grochowiak
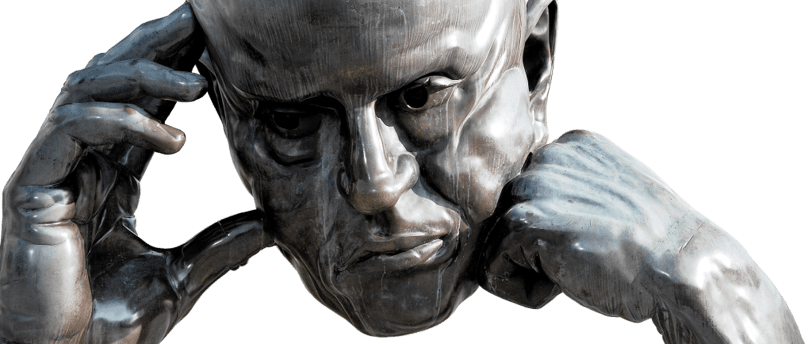
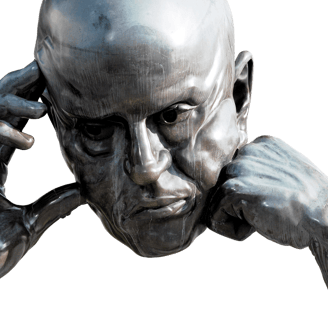
Seit alters her wird die Einheit des Bewußtseins in die Formen des Denkens und Wollens zergliedert. Das Denken, soweit es die Welt denkt, ist immer Erinnerung, in dem Sinne, daß das Denken nur Denken kann, was geworden ist. Auf der anderen Seite “äußert” sich der freie schaffende Wille in seinen Möglichkeiten und läßt sie zur Wirklichkeit werden.
“Das in Entscheidungen lebende Ich der praktischen Vernunft erlebt sich in der Zeit. D.h. die Zukunft ist ihm die existentielle Dimension, in die es die Entwürfe seines Willens hinein zu bilden hat.
Entscheidungen fallen in der Zeit, weshalb sich die Zeit als von höherer metaphysischer Mächtigkeit erweist als der Wille. In dem Augenblick aber, in dem sich eine Entscheidung realisiert hat und damit unabänderlich geworden, freie Möglichkeit gewesen ist, sinkt die Zeit zum bloßen Gegenstand der ‘Erinnerung’ herab.” (G. Günther, Wahrheit, Wirklichkeit und Zeit)
1. Die Zeit ist von höherer Mächtigkeit als der Wille
2. Das Denken besitzt höhere Mächtigkeit als die Zeit
Das heißt die Vergangenheit als Erinnerung ist etwas dem Bewußtsein Immanentes, die Zukunft aber ist der offene Horizont der Transzendenz, in die hinein das Ich seine Entscheidungen hinein projiziert.
Das Selbstbewußtsein, als Einheit von Denken und Handeln existiert real nur im JETZT. Das JETZT aber ist der Zeitfolge unbestimmter Augenblick der Gegenwart. Wie also ist das Verhältnis von Denken und Wollen im Jetzt zu Denken? Das Denken als Existenz ist Handlung, sagt Fichte mit tiefer Einsicht in diesen Zusammenhang. Daraus folgt:
3. Der Wille entwickelt eine höhere Mächtigkeit als das Denken.
Aus all dem folgt, daß sich das Zeitproblem auch nicht auf das unmittelbare Verhältnis von Handeln und Denken reduzieren läßt. Es geht also um eine “Vermittlung der Zeit im Bewußtsein und Vermittlung des Bewußtseins in der Zeit.” (G. Günther, Wahrheit,…)
Die Situation verkompliziert sich aber noch dadurch, daß uns Denken und Handeln in der wirklichen Welt immer in der doppelten Form von Ich-haftem, eigenem Denken und Handeln und Du-haftem, fremden Denken und Handeln begegnet. Desweiteren ist jedes konkrete Leben ein endliches und insofern ist die individuelle Zukunft begrenzt durch den Tod. D.h. unsere Existenz ist immer ein Dasein- zum-Tode. Als solches ist unser Leben auch immer ein noch-nicht und verlangt von uns einen Entwurf, einen Selbstentwurf.
Der Tod nun wird entweder als das Ende der individuellen, privaten Subjektivität thematisiert oder aber als der Zeitpunkt, an dem die Seele den Leib verläßt, um in eine andere Existenzebene überzugehen. Die Idee einer Postexistenz des privaten Ichs wird allerdings interessanterweise mit der Idee eines zweiten Leibes verknüpft. Dies sowohl in der christlich-paulinischen Auferstehungsidee als auch in den verschiedenen esoterischen Lehren vom Astralleib.
Für die klassische Weltauffassung ist klar, daß der Tod nicht bestimmbar ist wie anderes Seiendes unter anderem auch das Sterben. Der Tod kann nie Gegenstand einer Erkenntnis sein. Deshalb wird der Tod als das “grundlos Verschlossene” verstanden. Wenn auf den Tod keine Seinsbestimmung anwendbar ist, dann allerdings auch nicht das Nichts als dem Gegen-Sein (Subjektivität) des Seins. Denn im Tod existiert ja gerade die lebendige Subjektivität nicht mehr.
Wenn wir aber noch eine zweite Negation einführen oder allgemein zu einer mehrwertigen Logik übergehen, dann eröffnen wir damit eine neue Dimension des Negativen, die nicht mehr als die Negation des Seins, sondern als “reine Negativität des ichhaften Bewußtseins dem mehrwertigen Denken einen unendlich differenzierten und logisch bestimmbaren Aufriß der ‘subjektiven’ Introzendenz der sich selbst innehaften Reflexion.” (G. Günther, Ideen zu einer Metaphysik des Todes)
Neben der Frage nach der Zeit und dem Tod sehen wir uns angesichts der Frage der Zukunftsgestaltung dem Problem der Handlung gegenüber. Natürlich ist jede Handlung erst einmal ein Ereignis in der Welt, etwas, was geschieht. Aber hier soll nicht nur etwas passieren, sondern es wird etwas getan. Wir haben es mit einem von einem zielbewußten Willen gelenkten Ereignis zu tun.
Handlung hat immer die Aufgabe, im Unentschiedenen Entscheidungen herbeizuführen.
Die nächste Frage, die sich jetzt stellt, ist die, woher der Wille seine Intention nimmt, die seine Handlung leitet. Denn mögliche Handlungsmotive sind ihrem Wesen nach symmetrisch. Ich kann mit guten Gründen jede Handlung und ihr Gegenteil vertreten. Die Handlung macht dem Schwanken ein Ende und zwar ganz pragmatisch.
Die Handlung und der Wille haben ihren Ort also im Faktischen und im Kontingenten. Nur hier gibt es überhaupt Raum für das Bewußtsein als Wille und freie Handlung. Das subjektlose Sein ist so und so und nicht anders.
“Und hier hakt der Wille ein, der zwar immer nur sich selbst, aber sich selbst in der negativen Kontingenz einer noch nicht durchgeführten Empirie sucht. Vergegenwärtigt man sich, daß Hierarchie das genaue Gegenteil von Kontingenz, nämlich Grund und Notwendigkeit, beschreibt, daß Heterarchie aber ihre Wurzel im factum brutum findet, dann läßt sich sagen, daß wir im hierarchischen Prinzip das Wesen der Objektivität und im heterarchischen die Idee der Subjektivität dargestellt finden.” (G. Günther, Als Wille verhält sich der Geist praktisch)
Solange das Thema also das Sein, die Objektivität darstellt, haben wir es mit folgender Reihenfolge zu tun:
NOTWENDIGKEIT
WIRKLICHKEIT
MÖGLICHKEIT
Gehen wir aber zu einer die Zukunft eröffnenden Praxis über, dreht sich die Reihenfolge um:
MÖGLICHKEIT
WIRKLICHKEIT
NOTWENDIGKEIT
Wir können die Situation wie folgt zusammenfassen:
Das Subjekt wird in eine Welt hineingeboren, von der es abhängig ist und an die es sich anpassen muß. Andererseits hat es in bestimmtem Maße auch einen Spielraum, in dem es Entscheidungen treffen kann, um dadurch die Welt und sich selbst zu verändern.
Im ersten Fall ist das Subjekt von seiner Umgebung bestimmt. Dies ist die klassische Position. Die Wahrheit liegt im Sein, sie kann nur besser oder schlechter erkannt werden.
“Tritt das Subjekt als Handelndes auf, hat sich die Hierarchiebeziehung umgekehrt, das Subjekt verhält sich als Subjekt und macht sich seine Umwelt zum Objekt seiner Entscheidung, seines Handelns.” (K. Klagenfurt, Technologische Zivilisation und transklassische Logik)
Wie sind die beiden Grafiken zu Kognition (Denken) und Wollen zu interpretieren? Bei der Kognition, beim Erkennen der Welt hat die Welt den hierarchischen Vorrang (Æ Ordnungsrelation) und das Denken bewegt sich im Rahmen der Umtauschrelation (´) von Position und Negation.
In der Handlungssituation dominiert das Subjekt seine Umgebung und zwingt ihm seinen Willen auf. Die Ordnungsrelation kehrt sich also um. Die Umtauschrelation besteht jetzt zwischen den Handlungsalternativen.
Nun ist es unmittelbar einsichtig, daß jede Kognition einen Willensakt voraussetzt und jeder Willensakt eine Erkenntnis. Um etwas erkennen zu können muß ich mich entschließen es erkennen zu wollen, und um mich zwischen oder für etwas zu entscheiden, muß ich das selbe als solches bereits erkannt haben.
Die Relation, die Denken und Handeln vermittelt, nennt G. Günther Proemialrelation. “Die Simultaneität von volitiven und kognitiven Akten läßt sich als das Selbst eines
selbstorganisierenden Systems im Sinne eines lebenden Systems verstehen. Das Selbst ist nicht positiv bestimmbar, weil es weder dem volitiven noch dem kognitiven System zuzuordnen ist. Das Selbst ist der Mechanismus des Zusammenspiels von Kognition und Volition selbst. Dieser Mechanismus ist selbst nicht wieder ein kognitiver oder volitiver Operator und daselbst auch nicht der Träger von beiden. Daher gibt es keinen Referenten, der als das “Selbst” designierbar wäre. Damit gibt es aber auch keine Wahrheit des Selbst, wenn Wahrheit Unverborgenheit, aletheia, heißt (R. Kaehr 1989, 36–37).
Dadurch erhält das Selbst jedoch keinen außerweltlichen Platz. Etwa in dem Sinne, daß der Aktor immer außerhalb seiner Aktivität in einem unzugänglichen Jenseits angesiedelt wäre. Kognitive und volitive Akte sind simultan und gegenläufig; es gibt keine Kognition ohne Volition und umgekehrt keine Volition ohne Kognition, beide sind zugleich, daher kann es kein isolierbares und benennbares, d.h. nominalisierbares Selbst geben, das zusätzlich zu Volition und Kognition existieren würde. Das Selbst ist somit der nicht-nominalisierbare Mechanismus des proömischen Zusammenspiels zwischen Kognition und Volition. Die Argumentation gegen die Nominalisierung gilt auch, wenn zur Kognition und Volition weitere Funktionen hinzugenommen werden.
“Damit löst sich auch die Tautologie und Paradoxie Maturanas “Leben ist Erkennen und Erkennen ist Leben” auf in ihre Proömik. Wird die Tautologie als Chiasmus verstanden, dann löst sich die Identität auf in ein proemiales Zusammenspiel von Grund und Begründetem bzgl. Leben und Erkennen.” (R. Kaehr, Zur Philosophie des Selbst, S. 26)
“Das Selbst eines autonomen Systems ist die Proemialität von Kognition und Volition. Damit ist darauf hingewiesen, daß Selbstheit eines autonomen Systems gleichursprünglich mit Welterschlossenheit und Geschichtlichkeit des Systems ist.
Die Welterschlossenheit der Selbstheit eines lebenden Systems läßt sich nicht in den Kategorien der Informationsverarbeitung, der materiellen, energetischen und informationellen Input–Output- Operationen explizieren. Selbstheit, Autonomie und Welterschlossenheit sind nicht ontische, sondern ontologische bzw. Reflexionsbestimmungen eines Systems.”(R. Kaehr, Zur Philosophie des Selbst, S. 29)
Diese Überlegungen sind für das NLP insofern von großer Wichtigkeit, als es bei den Entscheidungsstrategien und bei der generellen Frage:
WAS SOLL ICH TUN ?
WAS WILL ICH ?
WAS SOLL ICH WOLLEN?
immer um die Frage nach dem Verhältnis von Weltverstehen und Entscheidung geht.
Viele Menschen versuchen das Entscheidungsproblem dadurch zu “lösen”, daß sie nach dem richtigen Weg suchen. Dies läuft in letzter Konsequenz darauf hinaus, daß man versucht, die Entscheidung durch Wissen zu ersetzen. Dies ist jedoch unmöglich! Ich kann die Entscheidung auf einen Abgleich des IST-ZUSTANDES mit irgendwelchen SOLL-WERTEN zurückführen, dann entsteht der Eindruck, daß ich nicht mehr entscheiden muß, sondern nur noch entsprechend dem MATCH bzw. MISMATCH handeln muß. Dabei wird aber vergessen, daß ich mich für die Kriterien, Werte, Ziele etc. entscheiden mußte. So gesehen ist jede echte Entscheidung ohne Grund. Diese Situation nennt man in den asiatischen Weisheitslehren “Handeln ohne zu handeln”. Hier erfährt sich die Subjektivität als bodenlos und jeder Halt erscheint willkürlich.
Auf der Ebene der Metaprogramme stellt sich die Situation wie folgt dar:
1. Der “Betrachter-Typ” versucht um die Entscheidung ganz herum zu kommen, indem er in der Kontemplation bleibt und sich alle Optionen offen hält. Er läßt sich von dem Gang der Ereignisse entscheiden.
2. Der “Entscheider-Typ” ist zwar schnell mit Entscheidungen und Bewertungen zur Hand, allerdings um den Preis, daß keine Reflektion auf die die Entscheidung ermöglichenden Kriterien erfolgt.
Es scheint also so zu sein, daß keiner von beiden sich mit dem Wesen der Entscheidung und des Willens wirklich auseinandersetzt.
Denken und Wollen in der Kybernetik
Da sich NLP schon in seinem Namen (Programmieren) auf die Kybernetik beruft, können wir an dieser Stelle fragen, wie denn die Kybernetik das Verhältnis von Denken und Wollen denkt.
In der Kybernetik wird davon ausgegangen, daß das materielle System, welches die Grundlage des Bewußtseins darstellt, für dieses Bewußtsein prinzipiell weder erlebbar noch denkbar ist.
“Man stellt fest, daß für jedes mögliche Bewußtsein das physische System (Gehirn), an dem es orientiert ist, »unterspezifizierten« Charakter hat (MacKay).” (G. Günther, Das Bewußtsein d. Maschinen, S. 122)
Dies gilt allerdings nicht für einen Beobachter von außen. Für ihn erscheint das System Gehirn und Nervensystem in jedem Moment als »voll-spezifiziert« oder als ein System, das wie alle materiellen Systeme dem Gesetz von Ursache und Wirkung unterliegt, also ein strikt determiniertes System. Würde der externe Beobachter etwas anderes annehmen, dann müßte er irgendein nicht-materielles Etwas annehmen.
Dies ändert aber nichts an der Tatsache, daß keine Ich-Subjektivität, die sich in Gedanken als frei erlebendes Bewußtsein begreift, den “Gesamtzustand des betreffenden physischen Systems als vereinbar mit mehr als einem Zustand seiner Teile”(G. Günther) erleben wird.
Die vollspezifizierte Subjektivität ist die DU-Subjektivität und die unterspezifizierte ist die ICH- Subjektivität. Insofern kann gesagt werden, das jede objektivistische Theorie der Subjektivität den freien Willen immer für eine Illusion halten muß. Der Wille, wie er im Ich-Erlebnis auftaucht ist also die Signatur der Subjektivität, die nicht auf Materielles zurückführbar ist.
Der Jahrtausende alte Streit zwischen Determinismus und Freiheit beruht also auf einem “logischen Indeterminismus unserer Bewußtseinsvollzüge” (G. Günther). Jedes Ich kann als Du thematisiert werden und umgekehrt.
Freiheit bedeutet streng genommen, keinen Grund zu haben etwas so oder so zu entscheiden – reines Umtauschverhältnis- eins ist so gut wie das andere. Wir überlisten uns dann oft selbst, indem wir irgendeine Proportion einführen (K+ ist besser als K- usw.) und vergessen darüber, daß wir auch dies entscheiden müssen.
Um entscheiden zu können müssen wir aber eine Proportion, ein Wertverhältnis einführen und wenn es auch nur ein Abzählreim ist, für den wir uns entscheiden.
“(Aber) diese Akzeption des Umtauschverhältnisses als Basis einer Entscheidung zwischen den Verhältnisgliedern hat die paradoxe Wirkung, daß eben durch jenes Akzeptieren das Umtauschverhältnis, als logisches Fundament der Freiheit, verloren geht.” (G. Günther, Das Bewußtsein…, S. 149)
Günther weist in seiner Arbeit nun darauf hin, daß ein System, dem wir die Eigenschaft der Selbstreflexion zubilligen, nicht nur die Möglichkeit hat, zwischen zwei gleichwertigen Alternativen zu wählen, sondern daß es darüber hinaus noch die Möglichkeit hat, die Alternative als Ganze zu verwerfen. Dadurch entsteht eine neue Alternative, die zwischen Akzeption und Rejektion von Reflexionszuständen.


